Hauptstadtgespräche
Charlottenstr. 47 | Berlin-Mitte
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land
von Dr. Klaus Ritgen, Deutscher Landkreistag
 Minister Karl-Heinz Schröter, Prof. Dr. Lars P. Feld, Walter-Eucken-Institut, Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Deutscher Landkreistag, Landrat Reinhard Sager, Bundesminister Christian Schmidt, Georg Fahrenschon, Deutscher Sparkassen-und Giroverband (v.l.n.r.)
Minister Karl-Heinz Schröter, Prof. Dr. Lars P. Feld, Walter-Eucken-Institut, Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Deutscher Landkreistag, Landrat Reinhard Sager, Bundesminister Christian Schmidt, Georg Fahrenschon, Deutscher Sparkassen-und Giroverband (v.l.n.r.)
alle Fotos: © Stein-Gesellschaft/Michael Fahrig
Deutschlands Stärke beruht zu einem großen Teil auf den Potenzialen seiner ländlichen Räume. Anders als in vielen anderen Staaten spielt sich das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben nicht nur in einigen wenigen Ballungsräumen ab, sondern auch in den Landkreisen sowie den kleineren Städten und den Gemeinden. Ob eine Stadt, ein Landkreis oder eine Gemeinde im Zentrum oder an der Peripherie liegt, sagt für die Entwick-lungschancen der jeweiligen Kommune daher wenig aus.
Die besondere Bedeutung des ländlichen Raums für Deutschland hat nicht zuletzt historische Gründe, beruht aber auch auf einem breiten politischen Konsens, der dazu geführt hat, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land als Wert in der Verfassung zu verankern. Diese Gleichwertigkeit stellt sich freilich nicht von selbst ein; darum muss vielmehr stets aufs Neue gerungen werden. Sie ist aktuell insbesondere durch den demografischen Wandel bedroht, in dessen Folge eine Reihe von Gebietskörperschaften des ländlichen Raums mit massiven Bevölkerungsverlusten rechnen müssen, während anderenorts – und zwar keinesfalls nur in den Ballungsgebieten – ein Anstieg der Bevölkerung zu erwarten ist. Welche Effekte insoweit die Flüchtlingszuwanderung haben wird, lässt sich noch nicht beurteilen. Mit der Wohnsitzregelung ist jedenfalls die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die integrativen Potenziale des ländlichen Raums zugunsten der betroffenen Menschen, durchaus aber auch zugunsten der ländlichen Kommunen genutzt werden können.
Technologische Entwicklungen wie die Digitalisierung könnten dazu führen, dass der ländliche Raum den Anschluss verliert, wenn die erforderlichen Infrastrukturen hier nicht zeitnah zur Verfügung stehen. Sollte dies aber gelingen, birgt die Digitalisierung große Chancen für den ländlichen Raum, auch wenn noch nicht vollständig absehbar ist, welche Auswirkungen dieser Wandel auf die hergebrachten Strukturen der „analogen“ Welt hat. Entscheidend für die dauerhafte Überlebensfähigkeit des ländlichen Raums ist aber wohl die Bereitschaft der maßgeblichen Akteure zu eigenverantwortlichem Handeln. Den Wettbewerb mit den Ballungsräumen können die Landkreise sowie die ländlichen Städte und Gemeinden nicht gewinnen, wenn sie versuchen, deren genaues Abbild zu werden.
Gleichwertigkeit, nicht Einheitlichkeit ist das Ziel. Deshalb darf die staatliche Unterstützung der ländlichen Räume, deren Notwendigkeit außer Frage steht, diese Eigenverantwortlichkeit nicht ersticken, sondern muss sie bewahren. Das betrifft nicht nur die Ausgestaltung der Förderinstrumente; erforderlich sind vielmehr auch eine aufgabenangemessene Finanzausstattung der Kommunen sowie die Möglichkeit zur eigenverantwortlichen Gestaltung auch der Einnahmenseite. Nicht zuletzt müssen auch die kommunalen Strukturen den sich wandelnden Herausforderungen angepasst werden. Gebiets- und Funktionalreformen sind daher auch eines der Instrumente zur Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land.
Mit diesen wenigen Sätzen lassen sich in aller Kürze die Ergebnisse des 10. Hauptstadtgesprächs der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft, das am 7.9.2016 in den Räumen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes in Berlin stattfand, zusammenfassen. Mit der „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land“ war die Veranstaltung am Vorabend des 100. Geburtstags des Deutschen Landkreistags einem Thema gewidmet, das diesen kommunalen Spitzenverband, der sich selbst als Anwalt des ländlichen Raums versteht, seit seiner Gründung beschäftigt. Der ländliche Raum und insbesondere die Frage der kommunalen Selbstverwaltung in den Kreisen hat aber auch das Wirken des Freiherrn vom Stein geprägt, der eben nicht nur als Urheber der preußischen Städteordnung von 1808 zu den Vätern der Selbstverwaltung in Deutschland gehört, sondern dessen Gedanken und Ideen stets auch um die Verwirklichung der Selbstverwaltung auf dem von ihm so genannten „platten Land“ kreisten, auch wenn es – den Zeitläuften geschuldet – unter seiner Ägide als preußischer Staatsminister nicht mehr zum Erlass der schon im Entwurf vorliegenden Kreisordnung kam.
An diese Traditionslinien knüpfte der Präsident der Gesellschaft, Dietrich H. Hoppenstedt, an, als er in seinen Ausführungen zur Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste deutlich machte, dass Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern Europas seine Stärke gerade auch aus dem ländlichen Raum gewonnen habe und dass schon immer viel zur Entwicklung des ländlichen Raums getan worden sei, allerdings auch in Zukunft getan werden müsse. Denn das in der Verfassung verankerte Ziel der „Gleichwertigkeit“ der Lebensverhältnisse verlange nach politischer Gestaltung und verwirkliche sich nicht von selbst. Der ländliche Raum habe gute Voraussetzungen für eine gedeihliche Entwicklung, die am Ende dem gesamten Land zugutekomme. Es müssten aber, namentlich auf dem Gebiet der Infrastrukturen, auch eine Reihe von Defiziten kompensiert werden, wenn – im ursprünglichen wie im übertragenen Sinne des Wortes – der Anschluss an die Ballungsräume nicht verloren gehen solle. Das Land biete Freiräume für die Entfaltung schöpferischer Kräfte, in den überschaubaren Lebenswelten der kleineren Städte und Gemeinden – aber auch auf der Ebene der Landkreise – finde bürgerschaftliche Verantwortung ein reiches Betätigungsfeld, nicht nur im Bereich der Kommunalpolitik. Auch die Identifikation mit dem Gemeinwesen falle vielfach leichter als in der Anonymität der großen Städte. Das alles, so Hoppenstedt, seien Faktoren, die es zu erhalten und zu stärken gelte, und zwar auch gegenüber einer Politik, die als Preis für finanzielle Unterstützung den Verzicht auf Gestaltungsspielräume einfordere.
Wie also gelingt es – gerade auch vor dem Hintergrund der neuen Herausforderung der Flüchtlingsintegration – die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse für die Zukunft zu sichern? Ist der ländliche Raum stark genug, um der vermeintlichen oder tatsächlichen Sogwirkung der Ballungsräume standzuhalten? Brauchen wir im Grundgesetz eine neue „Gemeinschaftaufgabe“, etwa zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge in schrumpfenden und strukturschwachen Kommunen des ländlichen Raums? Das sind die Fragen, die Hoppenstedt den Diskutanten mit auf den Weg gab.
Auf dem hochrangig besetzten Podium vertreten waren der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Christian Schmidt, der Minister für Inneres und Kommunales des Landes Brandenburg, Karl-Heinz Schröter, der Präsident des Deutschen Landkreistags, Landrat Reinhard Sager (Kreis Ostholstein), der Leiter des Walter Eucken-Instituts der Universität Freiburg, Lars P. Feld, sowie nicht zuletzt der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Georg Fahrenschon, der dankenswerter Weise auch die Rolle des Gastgebers übernommen hatte. Moderiert wurde die Runde durch das Geschäftsführende Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistags, Hans-Günter Henneke, zugleich Vorsitzender des Sachverständigenrates für ländliche Entwicklung.
Bestandsaufnahme: Wo steht der ländliche Raum?
Henneke leitete die Diskussion mit dem Hinweis ein, dass alle Podiumsteilnehmer mit der Ausnahme von Feld aus dem ländlichen Raum stammten und auf eine kommunalpolitische Vergangenheit zurückblicken könnten. Das gilt auch für Bundesminister Schmidt, dessen Heimat der selbst für bayerische Verhältnisse sehr dünn besiedelte Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Winsheim ist, der als Außen- und Sicherheitspolitiker aber auch auf der ganzen Welt Erfahrungen sammeln konnte und daher geradezu prädestiniert für die Beantwortung der Frage ist, mit der Henneke die Diskussion eröffnete und die darauf zielte, wo der ländliche Raum in Deutschland – auch im Vergleich zum Ausland – eigentlich stehe.
Schmidt ergriff zunächst die Gelegenheit, dem Deutschen Landkreistag zu seinem hundertjährigen Bestehen zu gratulieren und betonte die wichtige Mittlerstruktur der Landkreise im kommunalen sowie – als Träger der unteren Verwaltungsbehörden – auch im staatlichen Bereich. Er verwies darauf, dass der deutsche Föderalismus vor dem Hintergrund der Vielzahl kleiner und kleinster Staaten gesehen werden müsse, die früher auf deutschem Territorium existiert und auch den Erfahrungshorizont geprägt hätten, vor dem der Freiherr vom Stein und die anderen preußischen Reformer ihre Lehren entwickelt hätten. Eine Folge dieser historischen Entwicklung sei, dass es in Deutschland nicht ein Zentrum gebe, wie es Paris für Frankreich darstelle. Berlin sei zwar Hauptstadt, aber eben nicht die Hauptstadt, sondern lediglich eine von anderen gleichermaßen bedeutsamen Städten. Schmidt bewertete diese deutsche Multizentralität positiv, betonte aber auch, dass sich damit der „Kampf um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ nicht erledigt habe, sondern aktuell eher sogar noch fordernder geworden sei. Ein wesentlicher Faktor sei insoweit der demografische Wandel, dessen Auswirkungen allerdings regional unterschiedlich spürbar würden. So gebe es einerseits Landkreise, die in den nächsten Jahren mit einem sehr deutlichen Bevölkerungsrückgang um 30 Prozent und mehr zu rechnen hätten, während sich andere Landkreise – insbesondere in der Nähe von Ballungsgebieten – auf ein Bevölkerungswachstum einstellen müssten. Mitunter seien entsprechende Entwicklungen auch innerhalb eines Landkreises zu beobachten. Diese Veränderungen hätten zwangsläufig Auswirkungen auf die Sicherstellung einer ausreichenden Daseinsvorsorge vor Ort. Zugleich gewönnen Infrastrukturen an Bedeutung; sie seien nicht nur die Voraussetzung dafür, dass das Leben in den betroffenen Gebieten möglich bleibe, sondern auch für Neuansiedlungen dort. Deutschland – so Schmidt – setze sich seiner Erfahrung nach stärker für den ländlichen Raum ein, als seine Nachbarstaaten.
Auch Feld betonte, dass Deutschland nicht so zentralistisch gegliedert sei wie andere Staaten. Das begünstige einen Wettbewerb zwischen den Regionen, der sich häufig vorteilhaft auswirke, mitunter aber auch nachteilige Folgen zeitige. Es entspreche einer langen, auf zu Beginn des letzten Jahrhunderts entstandenen und später von dem Nobelpreisträger Paul Krugman fortentwickelten Lehren beruhenden Tradition, die Probleme des ländlichen Raums vor dem Hintergrund eines Gegensatzes zwischen Zentren und Peripherie zu diskutieren, wobei – wie zu ergänzen ist – den Zentren grundsätzlich die besseren Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt würden. Feld hält diesen Ansatz für verfehlt. Nach seiner Auffassung hat der ländliche Raum viele Chancen, wenn er seine Eigenverantwortung wahrnimmt. Unabdingbare Voraussetzung dafür sei die Ansiedlung von Gewerbe und Unternehmen. Der ländliche Raum brauche die „Wirtschaft als Entwicklungskern“. Zugleich warnte Feld vor den Folgen einer fehlgeleiteten Wirtschaftsförderung, die zu oft versuche, nicht lebensfähige Strukturen künstlich am Leben zu erhalten oder in Projekte investiere, die am Markt keine Chancen hätten. Wichtiger als die Förderung einzelner Unternehmen sei es daher, im ländlichen Raum Voraussetzungen zu schaffen, damit sich die Wirtschaft entwickeln könne. Zwei Faktoren spielen dabei für Feld eine zentrale Rolle. Für unverzichtbar hält er den Ausbau von Infrastrukturen, zu denen neben Verkehrswegen insbesondere auch ein leistungsfähiges Breitbandnetz gehöre. Außerdem müssten „Bildungskerne“ – vor allem Universitäten – geschaffen werden, um die Attraktivität gerade für junge Menschen zu erhöhen. Dabei gehe es nicht darum, überall identische Gegebenheiten zu schaffen; vielmehr sei auch eine Arbeitsteilung zwischen den Zentren und den ländlichen Räumen vorstellbar. Das Grundgesetz verlange schließlich auch nicht Einheitlichkeit, sondern Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.
Ebenso wichtig – und das ist Felds zweite Forderung – sei es, die Eigenverantwortung der Gebietskörperschaften zu erhöhen. Das gelte insbesondere auch auf der Einnahmenseite. Hier sieht er ein großes Manko, fehle es doch sowohl den Ländern wie den Kommunen – und namentlich den Landkreisen – an eigenen Steuerquellen von einigem Gewicht.
Kreisgebiets- und Funktionalreform: Die Antwort Brandenburgs auf den demografischen Wandel
Als Landrat des im unmittelbaren „Speckgürtel“ von Berlin verorteten ehemaligen Landkreises Oranienburg, dann als Landrat des Landkreises Oberhavel, der im Zuge der (ersten) brandenburgischen Kreisgebietsreform aus der Zusammenlegung von Oranienburg mit dem deutlich ländlicher geprägten Landkreis Gransee entstanden ist, und jetzt als Innenminister des Landes Brandenburg, das erneut vor einer Kreisgebietsreform steht, verfügt Schröter über einen langjährigen Erfahrungshintergrund, der sich aus verschiedenen Perspektiven speist. Darauf von Henneke angesprochen, bestätigt er zunächst, dass die Bevölkerungsentwicklung differenziert betrachtet werden müsse, mit der Folge, dass mancherorts ein Rückbau von Angeboten der Daseinsversorge unausweichlich werde, in anderen Gebieten dagegen neu infrastrukturelle Bedarfe entstünden. Es seien daher ausgleichende Mechanismen erforderlich, wie sie im ländlichen Raum insbesondere von den Landkreisen wahrgenommen würden. Mit der ersten Kreisgebietsreform in Brandenburg sei erreicht worden, dass möglichst viele Kreise einen unmittelbaren territorialen Anschluss an Berlin erhalten hätten. Das hätte es diesen Kreisen erleichtert, ihrer Ausgleichsfunktion nachzukommen. Bevölkerungsverluste in den peripheren Regionen hätten durch ein Bevölkerungswachstum in den berlinnahen Städten und Gemeinden ausgeglichen werden können. Angesichts einer solchen, in der Summe stabilen Bevölkerungszahl seien Anpassungen in der Struktur der Kreisverwaltung nicht erforderlich.
Grundsätzlich anders bewertet Schröter die Lage der Landkreise, die keinen unmittelbaren Anschluss an Berlin haben. Hier gebe es Bevölkerungsverluste in einem Ausmaß, die kommunales Verwalten schwer, mitunter sogar unmöglich machten. Insoweit gehe es nicht nur darum, dass die Kosten – bezogen auf die Bevölkerungszahl – immer weiter anstiegen und die ebenfalls bevölkerungsabhängigen Einnahmen zurückgingen. Sinkende Fallzahlen stellten vielmehr auch die Professionalität der Verwaltung in Frage. Eine funktionsfähige Verwaltung sei aber auch – ganz im Sinne der Äußerung von Feld – Voraussetzung für die Ansiedlung von Gewerbe und Unternehmen; die wirtschaftliche Entwicklung hänge nicht zuletzt davon ab, dass Bescheide schnell und rechtssicher erstellt werden könnten.
Vor diesem Hintergrund will Brandenburg nach Schröters Bekunden jetzt gegensteuern und neue Strukturen schaffen. Geplant sei nicht nur eine Kreisgebiets-, sondern auch eine Funktionalreform, also die Verlagerung einzelner Aufgaben von Behörden des Landes auf die Kreise. Dabei müsse man sehen, dass Verwaltungsvorgänge immer komplexer würden. Die Verantwortlichen sollten ihre Entscheidungen daher nicht nur gestützt auf Kenntnisse eines Ausschnitts der Lebenswirklichkeit treffen müssen, sondern die Chance erhalten, das Gesamtbild in den Blick zu nehmen. Sonst könnten Abwägungen nicht mehr sachgerecht erfolgen. All dies spreche dafür, Entscheidungskompetenzen zu konzentrieren, und zwar möglichst nahe bei der Aufgabe, also auf der Kreisebene. Schröter ist sich bewusst, dass es bis zum Erreichen dieses Ziel ein langer Weg ist. Es gelte, „dicke Bretter zu bohren“. Namentlich die Fachpolitiker im Landtag fürchteten, mit der Verlagerung von Verwaltungskompetenzen auf die Landkreise auch politischen Gestaltungsspielraum zu verlieren. Das sei freilich ein Irrtum. Mit Verwaltungsakten könne man keine Politik machen; insoweit gehe es nur um eine sachgerechte Ausübung des Verwaltungsermessens. Politische Gestaltung verwirkliche sich im Erlass von Gesetzen und Verordnungen; diese Kompetenzen blieben selbstverständlich unangetastet.
Attraktivität ländlicher Räume sichern
Einen von Feld eingeführten Gedanken aufgreifend betonte der Präsident des Deutschen Landkreistags und Landrat des Kreises Ostholstein, Sager, in seinem ersten Diskussionsbeitrag, die Landkreise hätten in der Vergangenheit bewiesen, dass sie zu eigenverantwortlichem Handeln in der Lage seien, und zwar nicht zuletzt, wenn es um die Frage der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum gehe. Sager stimmte Feld auch insoweit zu, dass es für die Entwicklung der ländlichen Räume maßgeblich auf die Wirtschaft ankomme und war sich mit ihm auch in der Frage einig, dass kommunale Wirtschaftsförderung – die allerdings grundsätzlich wichtig und richtig sei – keine falschen Anreize setzen dürfe: Wenn man merke, dass das Pferd zu Tode geritten sei, müsse man absteigen; die Errichtung von Gründerzentren dort, wo es keine Gründer gebe, mache keinen Sinn. Wirtschaftsförderung bedeute daher vor allem auch, für eine ausreichende Erschließung der ländlichen Räume mit Infrastrukturen zu sorgen. Namentlich der flächendeckende Ausbau von Glasfasernetzen bedeute eine große Chance für den ländlichen Raum. Dadurch würden Gewerbetreibende, aber auch die Angehörigen freier Berufe – Sager verwies insoweit auf Architekten, erwähnte aber auch den Bereich der Gesundheitsdienstleistungen – in die Lage versetzt, sich im ländlichen Raum anzusiedeln. Diesen Infrastruktursicherungsauftrag würden die Landkreise sehr ernst nehmen und könnten insoweit auch schon Erfolge vorweisen.
Landkreise und Sparkassen – Partner im ländlichen Raum
Die wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherung von Infrastrukturen im ländlichen Raum waren auch Gegenstand der ersten Frage, die Henneke an Fahrenschon richtete. Er erinnerte daran, dass Sparkassen zu drei Viertel Einrichtungen der Landkreise seien. Müsse – so Henneke – deren öffentlicher Auftrag nicht so gestaltet werden, dass die (kreis-) kommunale Wirtschaftsförderung sinnvoll unterstützt werde? Darüber hinaus seien die (Kreis-) Sparkassen mit ihren zahlreichen Filialen in der Fläche präsenter als die Kreisverwaltung selbst. Das bedeute einerseits, dass damit – im Sinne einer öffentlichen Infrastruktur – Anlaufpunkte vorhanden seien, werfe aber auch für die Sparkassen die die Landkreise seit Längerem bewegende Frage auf, ob und wie diese Strukturen angesichts des demografischen Wandels und bestimmter technischer Entwicklungen erhalten werden können und sollen.
Fahrenschon bekräftigte, dass es eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Sparkassen und den Landkreisen gebe und zog eine Parallele zur Struktur der kommunalen Selbstverwaltung im ländlichen Raum und zur Präsens der Sparkassen dort. So wie es den Landkreisen im Zusammenwirken mit den kreisangehörigen Gemeinden in einzigartiger Weise gelinge, ein breites Angebot für Menschen und Wirtschaft bereit zu halten, zeichneten sich auch die Sparkassen durch ihre große Nähe zu Bürgern und Unternehmertum sowie den Lebensverhältnissen und Bedürfnissen vor Ort aus. Darauf beruhe die Bedeutung der Sparkasseninstitute für das deutsche Kreditwesen im Ganzen und namentlich für die Kreditversorgung des Mittelstandes. Aufgrund ihrer starken regionalen Verankerung seien die Sparkassen aber auch ganz unmittelbar von den bereits angeführten, für die Entwicklung des ländlichen Raums maßgeblichen Umständen betroffen, nicht zuletzt vom demografischen Wandel. Fahrenschon betonte, dass es in Zukunft nicht mehr nur auf das Zusammenspiel der drei klassischen Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Boden ankomme, sondern dass mit „Daten“ und damit mit der Digitalisierung ein weiterer Faktor zu beachten sei. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse bedeute daher heute vor allem, dass auch der ländliche Raum Zugang zur digitalen Welt haben müsse.
Wie kann bzw. sollte die Entwicklung des ländlichen Raums gefördert werden?
Im Anschluss an diese erste Bestandsaufnahme wandte sich die Diskussion der Frage zu, wie die weitere Entwicklung des ländlichen Raums gefördert werden kann bzw. sollte? Auf Bundesebene fällt dies in erster Linie in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, so dass Henneke naturgemäß zunächst Schmidt fragte, was sein Haus in dieser Hinsicht plane.
Schmidt betonte, dass es sich bei der ländlichen Entwicklung um eine Notwendigkeit handele, derer sich jede Bundesregierung stellen müsse. Bei der Sicherstellung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gehe es nicht darum, Vorhandenes zu konservieren, sondern vielmehr um Transformation und Anpassung an die neuen Herausforderungen der Zukunft. Die bereits mehrfach erwähnte demografische Entwicklung spiele dabei eine besondere Rolle. Schmidt verwies insoweit auf eine Reihe konkreter Ansätze seines sowie anderer Ministerien, etwa zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum durch die Schaffung besonderer Anreize für „Landärzte“ oder die Initiative „Mehrfunktionenhäuser“. Allerdings dürfe der Bund in der Regel nicht durchgehend fördern, sondern müsse sich darauf beschränken, „Leuchttürme“ zu setzen.
Insoweit komme der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) eine besondere Bedeutung zu, die zu einem Instrument der Förderung ländlicher Entwicklung im Ganzen weiterentwickelt werden solle. Er hätte es begrüßt, wenn der Begriff „ländliche Entwicklung“ auch ausdrücklich in die Bezeichnung der Gemeinschaftsaufgabe aufgenommen worden wäre; dies hätte aber eine Änderung des Grundgesetzes vorausgesetzt. Dessen ungeachtet sei die GAK das wesentliche Instrument des Ministeriums, um gemeinsam mit den Ländern die ländliche Entwicklung zu fördern. Die Gemeinschaftaufgabe – eine Erfindung der großen Koalition der 1960er Jahre – habe sich im Übrigen bewährt. Auch wenn es immer wieder Versuche gegeben habe, sie abzuschaffen, habe sie sich bis heute erhalten und werde gerade grundlegend überarbeitet. Ziel sei dabei ein ganzheitlicherer Ansatz.
Nach seiner Auffassung, so Schmidt, seien die Dinge in der Vergangenheit zu sektoral angegangen worden; hier brauche es eine Trendwende. Dazu gehöre auch, dass sozioöko-nomische Fragestellungen stärker in den Blick genommen werden müssten. Letzteres betreffe insbesondere, aber nicht nur in den neuen Bundesländern auch die Bodenordnung. Hier stehe man vor der Herausforderung, dass die agrarische Ertragsfähigkeit der Böden gut, ihre ökonomische Ertragsfähigkeit aber begrenzt sei. Das finde in den Preisen für Flächen keinen realistischen Ausdruck mehr.
Ein weiterer Ansatz zur Förderung der ländlichen Entwicklung ist für Schmidt der Bereich der Ausbildung. Insoweit sei der Bund allerdings auf die Rolle als Mitspieler, allenfalls als Taktgeber beschränkt. Hier gelte es, neue Ideen zu entwickeln – auch auf das Risiko hin, dass sich am Ende nicht jede Maßnahme als erfolgreich erweise.
Ebenso wichtig sei die digitale Infrastruktur. Für dieses Handlungsfeld stelle zwar insbesondere das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Fördermittel zu Verfügung, auch im Haushalt seines Ministeriums stünden allerdings Gelder bereit. Mit digitalen Infrastrukturen lassen sich – so Schmidt – die Grenzen von Raum und Zeit unschwer überwinden. Das bedeute gerade für den ländlichen Raum eine große Chance, der insoweit auch als Impulsgeber fungieren könne. Die klassische Unterscheidung zwischen Peripherie und Zentrum verliere angesichts dessen an Bedeutung.
Zum Abschluss seines Betrags unterstrich auch Schmidt die Bedeutung der Sparkassen, die – zusammen mit den Genossenschaftsbanken – einen ganz wesentlichen Beitrag zur Kreditversorgung leisteten, den die großen Geschäftsbanken aufgrund ihrer anders gearteten Struktur nicht leisten könnten.
Auf Nachfrage von Henneke, der ankündigte, dass der Deutsche Landkreistag die Frage der Entwicklung des ländlichen Raums in den Mittelpunkt seiner Überlegungen mit Blick auf die nächste Bundestagswahl stellen und die Wertigkeit des ländlichen Raums in allen Politikfeldern herausstreichen wolle, erklärte der Minister, dass die Landkreise und sein Ministerium insoweit „strategische Partner“ seien. Er habe gelernt, wie wichtig eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten sei. Davon profitiere auch die Gemeinschaftsaufgabe. Diese positive Bewertung der Gemeinschaftsaufgabe verknüpfte Schmidt mit einer doch recht deutlichen Kritik an der Förderung nach dem europäischen LEADER-Programm, in dem eher die Kreativität der Finanzverantwortlichen belohnt, als die tatsächliche Interessenlage der Kommunen berücksichtigt würde.
Keine Verkürzung der Perspektive – Schwarmstädte als Beleg für die Heterogenität der Bevölkerungsentwicklung
Feld sprach sich in Reaktion auf die Äußerungen des Ministers noch einmal für eine stärker differenzierende Betrachtungsweise des tatsächlichen Befundes aus. Es sei in Deutschland eben gerade nicht so, dass die Entwicklung in den Zentren grundsätzlich gut, in der Peripherie dagegen grundsätzlich schlecht sei. Die Empirie zeige vielmehr, dass es sich gut entwickelnde ländliche Räume ebenso gebe wie Ballungsgebiete, die unter einer schlechten Entwicklung litten. Letzteres treffe z. B. auf das Ruhrgebiet zu. Ganz unabhängig davon, ob eine solche Entwicklung zu begrüßen sei oder nicht, gebe es also gerade keinen generellen Trend zur Landflucht. Auch in der Immobilienwirtschaft spreche man daher heute nicht mehr undifferenziert von einem Gegensatz zwischen Stadt und Land, sondern habe einige sog. „Schwarmstädte“ identifiziert, die sich allerdings in der Tat durch ein hohes Maß an Zuwanderung auszeichneten.
Was diese „Schwarmstädte“ von anderen unterscheide, sei ihre Attraktivität für jüngere Menschen, die wiederum entscheidend von den vor Ort vorhandenen Bildungsangeboten abhinge. Selbstverständlich könne man Städte, die nicht über eine universitäre Tradition verfügten, nicht ohne Weiteres in diese Richtung fortentwickeln. Wie etwa das Beispiel Frankfurt/Oder zeige, sei aber doch manches möglich, wobei wiederum viel von der Infrastruktur abhänge. Im konkreten Fall erlaube es die gute Infrastruktur zwar einerseits, dass zahlreiche der in Frankfurt/Oder eingeschriebenen Studenten nicht dort, sondern in Berlin wohnten. Ohne die gute Anbindung der Stadt hätten sich andererseits viele Studenten aber von vorneherein für einen anderen Studienort entschieden. Im Ergebnis profitiere Frankfurt/Oder jedenfalls, sei es von universitären Ausgründungen („spin-offs“), sei es, weil am Ende dann doch einige Studenten vor Ort blieben.
Vor diesem Hintergrund – so Feld – ist die Frage, wie Bildung organisiert werde, von entscheidender Bedeutung. Für Feld ist es positiv, dass insoweit eine Kompetenz der Länder bestehe. Wichtig sei aber auch, dass die Länder sich darüber einig seien, wie sie ihre Bildungsinvestitionen ausgestalteten.
Feld kam dann auf das Thema Wirtschaftsförderung zurück und sprach sich nochmals gegen Erhaltungssubventionen aus. Subventionen zur Wirtschaftsförderung sollten daher immer degressiv ausgestaltet sein und müssten regelmäßig überprüft werden. Kritisch fiel vor diesem Hintergrund auch seine Bewertung der Gemeinschaftsaufgaben aus. Mit denen habe man in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht.
Der ländliche Raum darf nicht zu einem nur randständigen Politikthema werden!
Auch Sager knüpfte an die Ausführungen des Ministers an und bedauerte, dass es nicht gelungen sei, die ländliche Entwicklung als Kernelement einer Fortentwicklung der GAK im Grundgesetz zu verankern. Auch deshalb wolle der Deutsche Landkreistag die ländliche Entwicklung zu einem Schwerpunktthema seiner politischen Bemühungen machen und damit auch darauf reagieren, dass sich die Politik vielfach stark auf die Großstädte fokussiere und die ländlichen Räume mitunter nur am Rande wahrnehme. Dem müsse entgegengetreten werden. Schon heute geschehe viel im ländlichen Raum, ohne dass dies immer ausreichend deutlich werde. Die Dinge würden sich noch besser entwickeln, wenn die Landkreise in die Lage versetzt würden, mehr in Infrastrukturen zu investieren. In jedem Fall habe der ländliche Raum Zukunft und müsse sich nicht verstecken. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass bspw. die Schulen im kreisangehörigen Raum sich vielfach in einem besseren Zustand befänden als in den Ballungsgebieten.
Als Innenminister Brandenburgs ist Schröter skeptischer, ob es nach der Bundestagswahl gelingt, die neue Bundesregierung ausreichend für die Probleme des ländlichen Raums zu sensibilisieren. Insbesondere die Flüchtlingszuwanderung wird seiner Erwartung nach dazu führen, dass die Metropolen lautstark und öffentlichkeitswirksam Unterstützung einfordern werden. Und es sei ja auch richtig: Die Flüchtlinge ziehe es zunächst dorthin, wo sie Ankerpunkte hätten, und das sei nun mal in erster Linie in den Städten der Fall. Deshalb seien in Brandenburg die Gemeinschaftsunterkünfte im berlinnahen Raum auch gut belegt, während in abgelegenen Gegenden Leerstände zu verzeichnen seien und selbst angebotene Wohnungen nicht genutzt würden. Notwendig – so Schröter – seien daher eigentlich klare und verbindliche Vorgaben zur Verteilung der Flüchtlinge; dafür zeichne sich aber keine Mehrheit im Bundesrat ab. Dabei ließen sich die Menschen in kleineren Einheiten besser integrieren. Hier falle es leichter, Zugang zu Sportvereinen zu erhalten, die Nachbarschafts-unterstützung gelinge besser, das Kennenlernen sei einfacher.
Schröter ging dann nochmals auf die in seinem ersten Statement nur kurz angesprochene Frage der Ausgestaltung der Finanzausgleichsgesetze in den Ländern ein. Damit die Landkreise ihre Ausgleichsfunktion auch in Zukunft wahrnehmen könnten, müsse der Flächenfaktor stärker berücksichtigt werden. In Brandenburg gebe es darüber hinaus die Überlegung, die Investitionskraft der Landkreise zu stärken. Dazu sollen Teile der Verbundmasse für Schwerpunktinvestitionen der Landkreise auf gemeindlicher Ebene genutzt werden. Insoweit sei zwar mit Widerstand des Städte- und Gemeindebundes zu rechnen, der befürchte, dass auf diese Weise kreisangehörige Kommunen durch die Landkreise gegängelt würden. Schröter betonte, sich von solchen Widerständen aber nicht beirren lassen zu wollen. Nach seiner Auffassung sind Schwerpunktinvestitionen wichtig für die Entwicklung des ländlichen Raums. Die Entscheidung, wo es solche Investitionen geben solle, könne aber nicht die Landesregierung, sondern müssten die Landkreise treffen. Gäbe es die Landkreise nicht, so müsse man sie erfinden: Dieses bekannte Bonmot des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau habe nach wie vor Richtigkeit.
Digitalisierung – Chance oder doch eher Gefahr für Strukturen im ländlichen Raum?
Er habe viel Ermutigendes im Hinblick auf die Zukunft des ländlichen Raums gehört, so fasste Henneke die Ergebnisse der Diskussion in einem Zwischenfazit zusammen, um dann die Frage zu stellen, ob sich aus der mehrfach angesprochenen und dabei positiv konnotierten Digitalisierung nicht auch Gefahren für den ländlichen Raum ergeben, weil sie körperliche Infrastrukturen überflüssig machen und damit faktisch auch zur Entleerung beitragen könne?
Auf dieses Thema angesprochen, betonte Fahrenschon, man dürfe den Blick nicht auf die Digitalisierung verengen. Es gebe vielmehr drei Kräfte, die die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen in den nächsten Jahren erheblich beeinflussen würden. An erster Stelle verwies Fahrenschon erneut auf den demografischen Wandel. Deutschlands Stärke habe schon immer auch in den Regionen mit ihrem Facettenreichtum und ihrer Innovationskraft gelegen. Wie dies angesichts der demografisch induzierten Veränderungen, die dazu führen könnten, dass ganze Landstriche „ausbluten“ und gleichsam „abgeschaltet“ werden könnten, erhalten werden könne, sei eine Frage, deren Tragweite in der Politik derzeit eher noch unterschätzt werde. Ähnlich „brutal“ werde sich nach seiner Einschätzung der Trend zu Negativzinsen auswirken. Dies bedrohe die Altersvorsorgekonzepte weiter Bevölkerungsteile und werfe eine neue soziale Frage auf. Auch mit Blick auf die Digitalisierung – dem dritten Faktor – ließen sich die Auswirkungen noch nicht vollständig erfassen. Wenn es richtig sei, dass Daten neben die hergebrachten Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital treten und wenn mit digitalen Geschäftsmodelle auch ganz neue Qualitätsstufen, z. B. im Dienstleistungsbereich, verwirklicht werden können, dann sei klar, dass die flächendeckende Erschließung des ländlichen Raums mit Breitband eine der zentralen Infrastrukturaufgaben sei, wichtig sowohl für die Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raums wie für die Teilhabe von Bürgern und Unternehmen an der allgemeinen Entwicklung. Dessen ungeachtet mahnte Fahrenschon auch dazu, über den Ausbau der neuen Netze die Sanierung der analogen Infrastrukturen nicht zu vernachlässigen.
Zum Abschluss trat er der von Henneke formulierten Sorge hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen der Digitalisierung entgegen: Es werde auch in Zukunft persönliche Ansprechpartner und die insoweit erforderlichen Infrastrukturen geben. Gerade die Sparkassen seien ein gutes Beispiel dafür. Das Internet könne den persönlichen Kundenberater nicht ersetzen.
Sicherstellung von Breitbandinfrastrukturen im ländlichen Raum
Wenn Kommunikationsinfrastrukturen die ihnen zugemessene Bedeutung für den ländlichen Raum haben, drängte sich die Frage, ob nicht mehr für den Breitbandausbau getan werden müsse, als – wie Henneke es ausdrückte – gemeinsam auf die Deutsche Telekom zu schimpfen – geradezu auf.
Schmidt ging darauf als Erster ein. Es habe ursprünglich die Idee gegeben, Unternehmen, die neue Infrastrukturen schaffen wollen, regulatorisch zu bevorzugen. Das habe nicht durchgesetzt werden können. Wenn es ein öffentliches Interesse am Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur gebe, dann müssten auch Instrumentarien geschaffen werden, mit deren Hilfe dies durchgesetzt werden könnte. Eine bloße Abwehrhaltung – wie man sie gegenwärtig etwa gegenüber den gerade verhandelten Freihandelsabkommen spüre – helfe insoweit nicht weiter.
Als Ökonom verwies Feld darauf, dass die marktbeherrschende Stellung der Deutschen Telekom ein Problem darstelle, dem durch eine staatliche Förderung nicht ohne Weiteres begegnet werden könne. Wichtig sei vielmehr, dass in einem wettbewerblichen Verfahren auch andere Anbieter zum Zuge kommen könnten. Man dürfe im Übrigen keine Mittel auf das Bemühen verschwenden, jeden Berghof mit Glasfaser anzubinden. Dafür stünden – wie Feld auf einen kritischen Einwurf von Fahrenschon bemerkte – andere, besser geeignete Technologien zur Verfügung. Unverzichtbar sei in jedem Fall ein klares Konzept, auf dessen Grundlage das weitere Vorgehen zu organisieren sei. Auch Feld gewann der Digitalisierung überwiegend positive Seiten ab. Selbstverständlich fielen bestimmten Tätigkeiten weg, dass müsse aber nicht zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen, weil gleichzeitig neue Aufgaben zu erledigen seien. Wichtig sei, dass alle Beteiligten flexibel agierten.
Kommunale Selbstverwaltung im Zeitalter der Digitalisierung
Wie aber sieht die Zukunft der Selbstverwaltung im Zeitalter der Digitalisierung aus? Wenn es mit Hilfe digitaler Infrastrukturen möglich ist, problemlos die Grenzen von Raum und Zeit zu überwinden – kann es dann noch kommunale Selbstverwaltung als notwendig gebietsbegrenzte und auf ein bestimmtes Gebiet bezogene Tätigkeit geben?
Diese Frage richtete Henneke an Schröter, der wie zuvor schon Fahrenschon bezogen auf die Sparkassen auch mit Blick auf die Verwaltung die Auffassung vertrat, dass es immer Dienstleistungen geben werde, die unmittelbar gegenüber dem Bürger zu erbringen seien. Das gelte insbesondere für die fürsorgende Verwaltung, also z. B. für die Sozial- oder Jugendhilfe oder für die Jobcenter. Solche Angebote könne man nicht zentralisieren und aus der Ferne elektronisch vorhalten. Verwaltungen, die sich mit solchen Themen beschäftigten, müssten auch in Zukunft „in der Nähe der Probleme“ angesiedelt werden, zumal die Menschen, die auf entsprechende Leistungen angewiesen seien, häufig weder ausreichend mobil noch internetaffin seien. Für Schröter steht daher fest, dass die Verwaltung in Kernelementen in den nächsten Jahrzehnten keinen Veränderungen unterworfen sein werde. Er wiederholte das bereits in seinem ersten Statement geäußerte Petitum, dass angesichts sinkender Fallzahlen die Professionalität nicht verloren gehen dürfe, so dass ausreichend große Grundgesamtheiten erforderlich seien.
Für die Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung – davon zeigte sich Schröter überzeugt – sei ferner wichtig, dass möglichst viel der zur Verfügung stehenden Finanzmitteln nicht in die Aufrechterhaltung von Verwaltungsstrukturen fließen dürfe, sondern für gestalterische Zwecke verwendet werden müsse. Kein Kreistagsabgeordneter wolle nur das Elend verwalten. Die Mitglieder der kommunalen Vertretungskörperschaften wollten vielmehr Entscheidungen zur kommunalen Infrastruktur treffen können. Also mehr Gestaltung, weniger bloße Verwaltung. Das mache die Kreise – ganz im Sinne des von Feld eingeforderten Wettbewerbs zwischen den Gebietskörperschaften – dann auch so vielfältig. Die Herausforderung liege daher in der Organisation einer möglichst ressourcensparenden Verwaltung, dann blieben ausreichende Mittel für die Verwirklichung einer lebendigen kommunalen Selbstverwaltung.
Dem stimmte Sager zu. Die Finanzausgleichsgesetze der Länder müssten regeln, dass die Kreise aufgabenangemessen finanziell ausgestattet würden. Im Übrigen dürften die Kreise im Rahmen einer Kreisgebietsreform nicht zu groß werden. Die Grenzen kommunaler Selbstverwaltung würden erreicht, wenn die Kreistagsabgeordneten die Lage vor Ort nicht mehr aus eigenem Augenschein beurteilen könnten.
Auch Feld war sich sicher: Digitalisierung und E-Government machen Verwaltung vor Ort nicht obsolet, was nicht heiße, das alles beim Alten bliebe. Auch im Rahmen von Kreisgebietsreformen müssten heute andere Probleme gelöst werden als früher. So sei davon auszugehen, dass es bestimmte Leistungen geben werde, die zentral über das Internet zur Verfügung gestellt werden könnten. Er habe vor diesem Hintergrund auch Zweifel, ob die Sparkassen das Netz ihrer Filialen in der bisherigen Dichte würden aufrecht erhalten könnten.
Fahrenschon hielt dem entgegen, dass Amazon und andere Internetanbieter nunmehr ihrerseits dazu übergingen, Filialen zu errichten. Es sei erkannt worden, dass es nicht ausreiche, seine Dienstleistungen nur im Internet anzubieten; dort komme die notwendige Interaktion zwischen den Menschen nicht zustande. Gerade die gestiegene Mobilität mache im Übrigen bessere E-Governmentangebote erforderlich. Noch ungelöst ist für Fahrenschon die Frage, wie es gelingen könne, die noch in der analogen Welt verwurzelten Mitarbeiter auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorzubereiten. Insoweit bedürfe es gezielter Personalentwicklungsprogramme.
Wohnsitzauflagen als Voraussetzung einer gelingenden Flüchtlingsintegration
Eine Diskussion über die Zukunft des ländlichen Raums kommt in diesen Tagen nicht an der Flüchtlingsfrage vorbei. Henneke griff daher auch dieses Thema auf und erinnerte daran, dass die letzten Wahlen mit ihren schlechten Ergebnissen für die etablierten demokratischen Parteien in überwiegend ländlich geprägten Bundesländern stattgefunden hätten. Er betonte ferner, dass der Deutsche Landkreistag – aus Solidarität mit den Verdichtungsräumen, aber auch aus innerer Überzeugung von ihrer Sinnhaftigkeit – für die Wohnsitzauflage eingetreten sei, um die Integration von Flüchtlingen auch in den überschaubareren Verhältnissen der Landkreise zu ermöglichen.
Sager griff dies auf und betonte, die Wohnsitzauflage müsse nun dringend realisiert werden. Sie sei auf Bundesebene zwar bereits beschlossen und stünde im Gesetz; die Länder machten von den neuen Instrumenten aber nur sehr zögerlich Gebrauch. Das müsse sich ändern – auch, um die Probleme auf dem Wohnungsmarkt in den Griff zu bekommen.
Schröter gestand ein, dass man in Brandenburg noch nicht so weit sei. Er machte aber deutlich, dass er hinter der Wohnsitzauflage stehe. Die Zuweisung von Flüchtlingen verbinde sich mit Chancen für die Landkreise wie für die Flüchtlinge. In den überschaubaren Verhältnissen des ländlichen Raums könnten Integrationsangebote zielgerichteter auf den einzelnen Flüchtling zugeschnitten werden. Die Integration in die Gesellschaft gelinge dort auch deshalb besser, weil die Notwendigkeit, sich wechselseitig anzunähern, größer sei als in der Anonymität der Ballungsräume.
Schmidt teilte die Auffassung von Sager und Schröter. Der Gefahr von Parallelgesellschaften könne eher in kleineren Strukturen begegnet, der vorhandenen Wohnraum besser genutzt werden, auch wenn es dessen ungeachtet in den Ballungsräumen einen Nachholbedarf beim sozialen Wohnungsbau gebe. Schmidt bekannte sich zur Idee von Integra-tionsvereinbarungen. Diese könnten Spezifika des regionalen Bereichs aufnehmen. Insoweit sei man noch nicht am Ende der politischen Überlegungen angelangt. Mit Blick auf die letzten Wahlen sprach der Minister von einem Verlust des „Urvertrauens“ in die Entscheidungen, die auf der Ebene des Bundes und der Länder – weniger auf kommunaler Ebene – getroffen würden. Das betreffe auch, aber nicht nur die Flüchtlingsfrage. Es zeige sich, dass es nicht ausreiche, für eine bestimmte Politik gute rationale Gründe vorweisen zu können. Gerade im Hinblick auf die Flüchtlingsintegration und namentlich im ländlichen Raum sei daher ein behutsames Vorgehen erforderlich.
Feld ergänzte, dass allein die Zahl der Flüchtlinge nicht dazu zwinge, den sozialen Wohnungsbau zu forcieren. In der Summe gebe es ausreichenden Wohnraum, dessen Nutzung durch eine Wohnsitzauflage sichergestellt werden könnte. Problematisch sei allerdings, dass es dort, wo es Wohnungsleerstände gebe, aktuell Arbeitsplätze nicht in ausrei-chendem Umfang zur Verfügung stünden. Die Wohnsitzauflage dürfe sich daher nicht als „dauerhafte Mobilitätsbremse“ auswirken. Wer einen Arbeitsplatz finde, müsse umziehen dürfen. Das Beispiel der Spätaussiedler und das für sie geltende Wohnortzuweisungsgesetz habe gezeigt, dass diese Ziele erreichbar seien, wenn ausreichend flexibel reagiert werden könne. Daher sei es gut, dass die Länder für die Umsetzung der Wohnsitzregelung zuständig seien. Klar sei aber auch, dass die Flüchtlingszuwanderung kontrollierter ablaufen müsse als in der jüngsten Vergangenheit.
Geborgenheit in gesichertem Fortschritt
Henneke griff zum Ende der Diskussion den von Schmidt angesprochenen Verlust des Urvertrauens der Wähler in die Politik auf und verwies auf eine Formulierung des Zeithistorikers Andreas Rödder, der mit Blick auf die Nachkriegszeit von einer Epoche der Geborgenheit in gesichertem Fortschritt gesprochen habe. Diese Geborgenheit sei es, die ein Stück weit verloren gegangen sei und wiedergewonnen werden müsse, wenn Ergebnisse, wie die in den letzten Landtagswahlen verzeichneten, künftig vermieden werden sollen. Auch dieses Thema gehört zu den Zukunftsfragen für den ländlichen Raum und bietet Stoff für weitere Hauptstadtgespräche, die Hoppenstedt in seiner Begrüßung so treffend als „politischen Salon“ bezeichnet hatte.
Programm
ab 18:30 Uhr | Eintreffen
19:00 Uhr | Begrüßung und Einführung
Dr. Dietrich H. Hoppenstedt Präsident der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V.
19:15 Uhr | Diskussion
Christian Schmidt Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft
Karl-Heinz Schröter Minister des Innern und für Kommunales Brandenburg
Prof. Dr. Lars P. Feld Leiter des Walter Eucken-Instituts, Universität Freiburg
Georg Fahrenschon Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes
Reinhard Sager Landrat und Präsident des Deutschen Landkreistages
Moderation und Zusammenfassung
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages und Vorsitzender des Sachverständigenrates für Ländliche Entwicklung
anschließend Imbiss
Die Veranstaltung wurde im Hause und mit freundlicher Unterstützung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes durchgeführt.
Die Dokumentation zum 10. Hauptstadtgespräch finden Sie als pdf-Datei hier:
AKTUELL
Format für Nachwuchs-Führungskräfte
24.-26. Oktober 2025
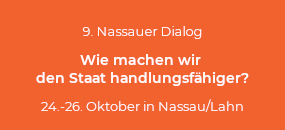
Leider ist keine Direkt-Bewerbung möglich!
» mehr
Cookies:
Diese Webseite nutzt Cookies um unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
