Sonderveranstaltungen
Hegelstr. 40-42 | 39104 Magdeburg
Kommunale Eigenverantwortlichkeit – tragende Säule der Demokratie
Text und Fotos von Dr. Klaus Ritgen, Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V.
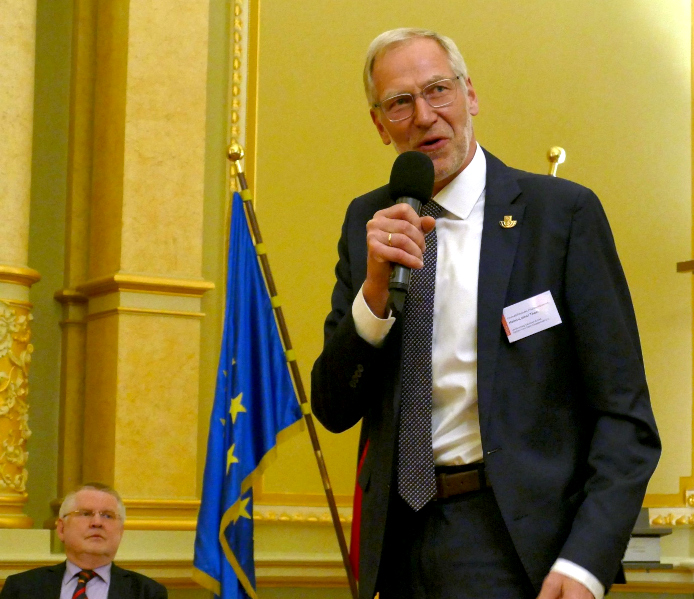 Heinz-Lothar Theel, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Landkreistages Sachsen-Anhalt a.D.
Heinz-Lothar Theel, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Landkreistages Sachsen-Anhalt a.D.
Bereits zum zweiten Mal nach 2013 fand am 4.3.2025 eines der traditionsreichen Hauptstadtgespräch der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft in Magdeburg statt. Aus Anlass des Ausscheidens von Heinz-Lothar Theel aus seinem Amt als Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Landkreistages Sachsen-Anhalt durchgeführt, konnten Staatsminister Rainer Robra als Hausherr sowie der Präsident der Gesellschaft, Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, zahlreiche Gäste im ausgebuchten Festsaal der Staatskanzlei des Landes begrüßen und zusammen mit der ehemaligen Ministerpräsidentin Thüringens, Christine Lieberknecht, dem Vizepräsidenten des Landkreistags von Sachsen-Anhalt, Landrat Markus Bauer (Salzlandkreis), und Prof. Dr. Martin Burgi (Universität München) über das Thema „Kommunale Eigenverantwortlichkeit – tragende Säule der Demokratie“ diskutieren.
Die Grußworte von Robra und Henneke sowie die Diskussion sind nachfolgend dokumentiert.
Rainer Robra
Staatsminister und Chef der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt
Grußwort
Liebe Familie Theel, meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie herzlich in der, wie wir gerne sagen, guten Stube des Landes Sachsen-Anhalt: dem Festsaal in der Staatskanzlei. Manche mögen sich fragen, wie ist sowas möglich, dass hier in Mitteldeutschland eine solche Pracht im Stile der italienischen Neorenaissance entfaltet wird.

Staatsminister Rainer Robra, Hausherr der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt
Dieses Haus ist Ende des 19. Jahrhunderts von einem hiesigen Baumeister errichtet worden, der gerne als der preußische Semper bezeichnet wurde und später in Berlin tätig gewesen ist. Es ist gebaut worden für das hiesige Armeekorps, aus einem, wenn man so will, ersten Sondervermögen in der deutschen Geschichte, und zwar dem Geld, das im Julius-Turm in Spandau aus den Kontributionen der französischen Armee nach dem deutsch-französischen Krieg gesammelt wurde – das war eine ganze Menge Geld. Wenige Jahrzehnte war die Lage dann umgekehrt und Deutschland musste zahlen. Aus diesen Mitteln hat das preußische Heer sich dann auch solche Festsäle geschaffen, um angemessen repräsentieren zu können. Für diejenigen unter Ihnen, die historische Feinschmecker sind, soll nicht unerwähnt bleiben, dass Hindenburg von 1903 bis 1911 hier seine letzte militärische Verwendung hatte, bevor er in den Ruhestand trat. Wäre die Geschichte damit beendet gewesen, wäre es Deutschland besser ergangen, aber er haderte mit seinem Schicksal schlich durch die Eilenriede in Hannover, bis er dann reaktiviert wurde und der weitere Verlauf der deutschen Geschichte ist bekannt.
Meine Damen und Herren,
ausnahmsweise findet das angesehene Hauptstadtgespräch nicht wie üblich in Berlin-Mitte statt, sondern, und das schon zum zweiten Mal, hier bei uns in Magdeburg. Für mich ist es insofern ein Déjà-vu, weil ich sie schon 2013, zwölf Jahre nach meiner Ernennung zum Chef der Staatskanzlei begrüßen konnte, und nun, wie es der Zufall will, nach weiteren zwölf Jahren hier erneut begrüßen darf. Damals hatte die Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft zu einer Sonderveranstaltung zum Thema „Die Zukunft des Landes Sachsen-Anhalt und seiner Kommunen zwischen Autonomie und bundesstaatlicher Solidarität“ eingeladen, seinerzeit noch in die Handwerkskammer Magdeburg. Anlass war, dass Herr Dr. Ermrich, den ich auch heute herzlich willkommen heiße, mit seiner Frau, liebe Frau Bremer, als Präsident des Landkreistages verabschiedet wurde. Damals wie heute durfte ich auf dem Podium sitzen. Jetzt sind wir wieder in Magdeburg, quasi zum zweiten Landeshauptstadtgespräch. Dafür gibt es gute Gründe.
Zum einen ist die im Grundgesetz realisierte föderale Ordnung in der Tendenz nicht auf Trennung, sondern auf Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen angelegt, wie es so schön in dem Begriff des kooperativen Kulturföderalismus zum Ausdruck kommt, den ich in meiner Eigenschaft als Kulturminister auch vital leben darf und dabei zu meiner großen Freude feststellen kann, dass sich mittlerweile selbst Bayern und andere Sonderlinge in der Bundesrepublik Deutschland damit abgefunden haben, dass auch der Bund fördern darf. Zum anderen findet dieses Hauptstadtgespräch als Ehrensymposium für Sie, lieber Herr Theel, statt. Nach 33 Jahren beim Landkreistag Sachsen-Anhalt, davon 21 Jahre als Geschäftsführer, wurden Sie, lieber Herr Theel, im Juni des vergangenen Jahres offiziell verabschiedet.
Aus diesem Anlass habe ich vor allem Ihre Expertise und Verdienste um den Aufbau kommunaler Strukturen in Sachsen-Anhalt nach 1990 gewürdigt. Sie waren der richtige Mann zur richtigen Zeit. Mehr als drei Jahrzehnte haben Sie sich erfolgreich und, ich will es auch heute gerne nochmal unterstreichen, wirklich allseits anerkannt für die kommunale Selbstverwaltung in Sachsen-Anhalt engagiert. Dafür danke ich Ihnen auch von dieser Stelle aus noch einmal herzlich und freue mich, dass auch Sie, Frau Prof. Berger, als Nachfolgerin von Herrn Theel heute unter uns sind.
Meine Damen und Herren,
 Heinz-Lothar Theel mit Familie sowie zahlreiche Gäste im Palais am Fürstenwall in Magdeburg
Heinz-Lothar Theel mit Familie sowie zahlreiche Gäste im Palais am Fürstenwall in Magdeburg
trotz aller Trends zur Globalisierung, die nach dem Motto „Nations First“ gerade zu enden scheint, ist die regionale Perspektive für viele Menschen die entscheidende. Der eine fühlt sich in seinem Bundesland oder vielleicht noch stärker in seiner Region zu Hause – und hier im Osten Deutschlands gibt es noch die Kategorie Ostdeutscher, die es im Westen als Westdeutscher ja gar nicht so gibt. Für andere aber bleiben die Stadt oder das Dorf der Bezugspunkt schlechthin. Für die meisten Menschen gilt, die alltägliche Lebenswelt ist nicht der Globus, sondern nur ein kleiner lebensweltlicher Ausschnitt darauf. Wir wollen mehr über unsere Kommune oder unsere Region erfahren, unseren Landkreis, denn hier liegen unsere Wurzeln, das ist unsere Heimat.
Auch deshalb ist Kommunalpolitik von zentraler Bedeutung. Auf örtlicher Ebene begegnen die Bürgerinnen und Bürger am unmittelbarsten Wohl und Wehe der öffentlichen Angelegenheiten. Der Vorzug der Nähe zeichnet die Kommunen seit jeher aus. Hier wird Politik unmittelbar greifbar. Die Allzuständigkeit der kommunalen Selbstverwaltung ist ein hohes Gut und die Kommunen sind das Fundament unseres demokratischen Staates. Blicken wir kurz zurück.
Reichsfreiherr von und zum Stein wollte das politische Selbstbewusstsein und das Interesse an der freiwilligen Mitarbeit im öffentlichen Leben fördern. Aus Untertanen – wir sind ja hier in Preußen in der ehemaligen preußischen Provinz Sachsen – sollten Bürger werden. Als Reformer des alten Obrigkeitsstaates war er in gewissem Sinne eine Zentralfigur des älteren deutschen Liberalismus.
Seine Grundgedanken begegnen uns auch heute wieder auf Schritt und Tritt, wenn wir an die Stichworte Subsidiarität, Eigenverantwortung, Gemeinsinn, Gemeinwohl und kommunale Selbstverwaltung, aber auch an überbordende Bürokratie denken. Darum geht es im Gespräch heute: Die kommunale Eigenverantwortung als tragende Säule der Demokratie.
Die kommunale Selbstverwaltung ist im Grundgesetz und in unserer Landesverfassung fest verankert. Sie ist ein hohes Gut.
Im April des vergangenen Jahres hat der Landtag von Sachsen-Anhalt das Gesetz zur Modernisierung des sachsen-anhaltinischen Kommunalrechts verabschiedet. Das zuvor letztmalig 2014 umfangreich aktualisierte Kommunalrecht hatte sich zwar grundsätzlich bewährt, aber manche Regelungen waren nicht mehr zeitgemäß und praxisnah.
Die Zeit bleibt nicht stehen. Deshalb sind Anpassungen immer wieder unumgänglich und auch dort gilt: semper reformandum – wer nicht immer wieder reformiert, wird von den Zeitläufen eingeholt.
Einer der Schwerpunkte der Modernisierung ist auch mit Blick auf den bei uns rasant verlaufenden Generationswechsel – die Geburtenzahlen gehen gerade so drastisch zurück, wie es sich vorher niemand hatte vorstellen können – die Verbesserung der Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche kommunale Mandat, das immer noch in der kommunalen Selbstverwaltung die tragende Säule ist, insbesondere im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Mandat.
Ferner geht es um die Stärkung der kommunalen Eigenverantwortung, Anpassungen an das kommunale Haushaltsrecht und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die kommunale Zusammenarbeit – auch ein bei uns jedenfalls besonders aktuelles Thema. Das neue kommunale Recht ist zukunftsgerichtet und gibt den Kommunen ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit vor Ort, das dann natürlich auch ausgeschöpft werden sollte.
Natürlich tangiert das auch die Finanzen. Die finanzielle Lage der Städte in Deutschland hat sich nach einer jüngsten Umfrage des Deutschen Städtetages dramatisch verschlechtert und für die Kreise gilt nichts anderes. Von den Städten schätzen 95% ihre Haushaltslage in den kommenden fünf Jahren als eher schlecht oder sogar sehr schlecht ein. Darauf wies Präsident Markus Lewe kürzlich hin und forderte die Schuldenbremse auf den Prüfstand zu stellen.
Darüber, meine Damen und Herren, kann und darf man nicht nur sprechen. Man spricht bereits darüber und die erste Antwort lautet einstweilen Sondervermögen, Sondervermögen, Sondervermögen. Dies auf der Ebene des Grundgesetzes. Selbst die Höhe, die 100 Milliarden für die Bundeswehr, ist im Grundgesetz festgeschrieben. Will man mehr, geht es nicht durch einfaches Gesetz, sondern nur auf dem Wege über die Verfassung. Ich bin gespannt, was da jetzt in den nächsten Tagen, solange der alte Bundestag noch handlungsfähig ist, zu uns gelangen wird.
Grundsätzlich müssen Bund, Länder und Kommunen aber gemeinsam für ein nachhaltiges Ausgabenniveau sorgen. Hier ein Job-Buddy, dort ein Verfahrensbegleiter, ein Verfahrenslotse: Gerade in jüngerer Zeit hat uns das Sozialrecht mit Figuren vertraut gemacht. Während die Verwaltung natürlich seit jeher auch Beratungs-, Auskunfts- und Hilfepflichten hat, bekommt heute jeder sozusagen nicht nur einen Anwalt, sondern auch noch einen Sozialarbeiter beigeordnet, dessen wesentliche Beschäftigung darin bestehen dürfte, die Sachbearbeiter der Verwaltung von der Arbeit abzuhalten, weil es ja darum geht, meinen Job-Buddy angemessen zu bedienen – und dann müssen halt mal die anderen warten.
Aber Investitionen in die Infrastruktur, Wissenschaft und neue Technologien müssen als Investitionen in die Zukunft weiter möglich sein. Verfassungskonforme Lösungen, darauf hat Ministerpräsident Dr. Haseloff, der Sie herzlich grüßen lässt, schon vor einiger Zeit zu Recht hingewiesen, sind möglich. Und dabei, auch hier feiert ein altes Instrument fröhliche Urstände, jetzt im Umfeld der Koalitionsverhandlungen, denke ich erst ganz zuletzt an die Einführung des Konnexitätsprinzips auf Bundesebene. Aber ich verrate da kein Geheimnis, manche denken daran. Und was das aus unserer Finanzverfassungsordnung machen wird, wage ich mir gar nicht vorzustellen.
Ein letzter Punkt: Stärker als bisher muss auf Digitalisierung gesetzt werden. Deshalb liegt ein Schwerpunkt in Sachsen-Anhalt auf der Neuausrichtung der Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen in der Digitalisierung. Wir haben da gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden Projekte entwickelt, die derzeit vorangetrieben werden.
Aber eins noch zu den Ergebnissen der Bundestagswahlen, weil ich jetzt nicht vor Ihnen stehen kann, ohne zuzugeben, dass 60% der Menschen in Sachsen-Anhalt – und in den anderen ostdeutschen Ländern ist es ja nicht wesentlich anders – Parteien am rechten und am linken Rand gewählt haben. Viele Menschen verstehen nicht mehr, was um sie herum geschieht. Die Politik und wir alle müssen Lösungen bieten, dürfen Probleme nicht länger nur verwalten.
Wir arbeiten an einer, wir nennen das als Arbeitstitel "Demokratieoffensive", die – wohlgemerkt – den Zweck verfolgt, die repräsentative Demokratie mit Elementen der Partizipation zu ergänzen und nicht durch partizipative Elemente zu ersetzen. Ich glaube, da hat es viele Fehlentwicklungen in den vergangenen Jahren gegeben, die der repräsentativen Demokratie eher geschadet als genutzt haben.
Und es gilt ein klares Profil zu zeigen. Wir machen das in Sachsen-Anhalt mit dem sogenannten Sachsen-Anhalt-Weg, den wir schon in der Covid-Pandemie so getauft hatten und uns damit auch ein bisschen von den anderen absetzen können. Seien Sie sicher, Sie werden bis zu unserer Landtagswahl, die im September 2026 ansteht, noch einiges vom Sachsen-Anhalt-Weg vernehmen. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke
Präsident der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistags
Begrüßung
Lieber Herr Robra, meine Damen und Herren,
herzlichen Dank für Ihr Grußwort und für die Einladung in dieses wunderbare Gebäude!
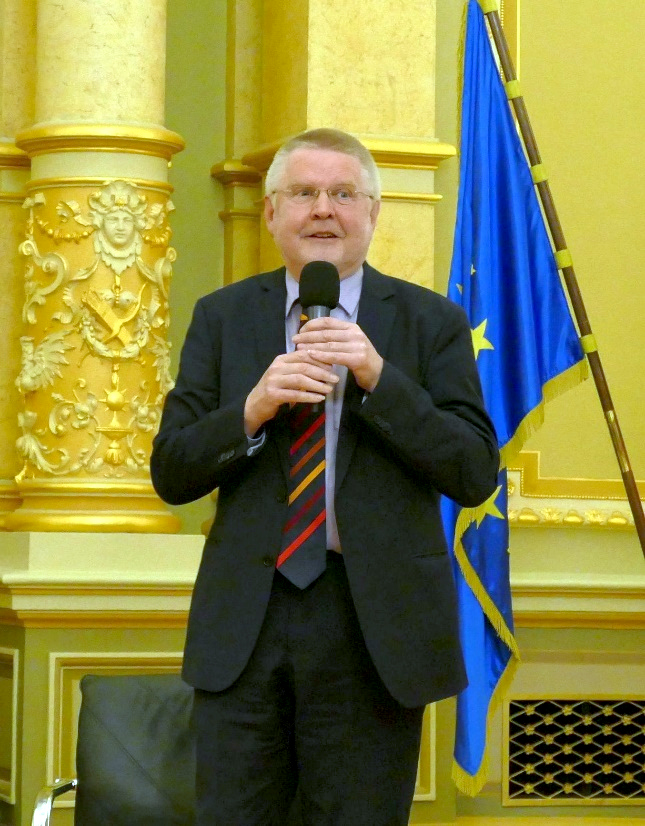
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Präsident der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V.
Ich könnte jetzt auf vieles erwidern: Warum wir das mit der Schuldenbremse anders sehen, warum wir gar nicht verstehen, dass Markus Lewe zitiert wurde, warum wir in Sachen Sondervermögen anderer Auffassung sind und dazu am 25.11.2025 ein Hauptstadtgespräch machen wollen. Das lasse ich alles weg, denn heute geht es vor allem darum, dass wir uns des Tages erfreuen.
Dietrich Hoppenstedt, mein Vorgänger im Amt des Präsidenten, hat es vor 15 Jahren übernommen, ein Selbstverständnis der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft zu entwickeln. Und dabei wurde – Stefan Dietrich, der hier zu unseren Gästen zählt, war dabei – der Name der Gesellschaft um den Zusatz „für mehr Eigenverantwortung“ ergänzt. Darum geht es uns heute: Um mehr Eigenverantwortung.
Ich darf in dieser Gesellschaft seit 1999 Verantwortung tragen und ich habe es erst zweimal erlebt, beide Mal in Magdeburg, dass Veranstaltungen zustande gekommen sind, weil Personen, die aus dem Amt verabschiedet wurden – erst Michael Ermrich und jetzt Heinz-Lothar Theel – zu Spenden aufgerufen haben, um eine Veranstaltung wie diese hier und heute auf die Beine zu stellen. Auch das ist Eigenverantwortung! Wir machen das ehrenamtlich, selbstverständlich. Aber Ihnen danke ich herzlich.
Herr Robra, der sozusagen zur Stammbesetzung unserer Veranstaltungen nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch in Berlin gehört, hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Stein-Gesellschaft Hauptstadtgespräche außer in Berlin-Mitte auch anderenorts veranstaltet. Und erst heute Nachmittag, anlässlich einer Präsidiumssitzung der Gesellschaft, haben wir in Kenntnis der hohen Anmeldezahlen für den Abend festgestellt, wir gut diese Gespräche außerhalb der Hauptstadt angenommen werden.
Deshalb noch einmal: Ganz herzlichen Dank allen, die hierher gekommen sind, um über ein wichtiges Thema zu sprechen, die aber natürlich auch und in erster Linie hierhergekommen sind, um Heinz-Lothar Theel und seiner Familie, Frau und Sohn, Danke zu sagen. Herr Robra hat das schon auf wunderbare Weise gemacht und für über 30-jährige Tätigkeit in Sachsen-Anhalt zugunsten der kommunalen Selbstverwaltung gedankt. Dem schließen wir uns an. Es ist uns eine Ehre, diese Veranstaltung heute durchführen zu dürfen!
Damit will ich überleiten zu denjenigen, die hier auf dem Podium sitzen. Wir haben hier zwei Landespolitiker, die in ungewöhnlich langer, intensiver, dabei aber auch in ganz unterschiedlicher Weise die Politik ihres Landes geprägt haben.
Zuerst begrüßen darf ich Frau Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht. Ich kenne niemanden, der so viele Ämter in einem Land durchgängig so lange ausgeübt hat, wie sie. Frau Lieberknecht war zuletzt fünf Jahre Ministerpräsidentin, davor aber auch schon Fachministerin in drei Ressorts, nämlich Kultusministerin, Sozialministerin, Bundesrats- und Europaministerin und – ebenfalls als Ministerin – auch einmal angesiedelt in der Staatskanzlei. Neben diesen Funktionen in der Exekutive hat sie auch noch für vier Jahre das Amt der Landtagspräsidentin wahrgenommen und war daneben etliche Jahre Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag von Thüringen. Wer also kennt besser Landespolitik in Thüringen als Christine Lieberknecht? Herzlichen Dank, dass Sie hier mitwirken und Ihre Erfahrungen einbringen.
Neben Frau Lieberknecht sitzt Martin Burgi, Hochschullehrer an der Universität in München, früher in Bochum, gebürtiger Baden-Württemberger, der also mit Sachsen-Anhalt nichts zu tun hat, hier aber einmal auf einer Landkreisversammlung referiert und dabei einen so bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dass Herr Theel ihn sich ausdrücklich als Gesprächspartner für den heutigen Abend gewünscht hat. Martin Burgi ist dem Deutschen Landkreistag seit März 2000 verbunden in einem alljährlichen Gespräch, das wir gerade in der letzten Woche wieder durchgeführt haben. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir einen hier haben mit dem Blick von außen auf ganz Deutschland und der das meistverbreitete Lehrbuch zum Kommunalrecht in Deutschland geschrieben hat. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Und damit zu Rainer Robra, den ich schon seit 2000 kenne. Er ist insofern das Gegenstück zu Christine Lieberknecht, weil er genauso lange – er hat es ja selber schon angedeutet - Regierungserfahrung hat, aber eben nicht in fünf oder sechs verschiedenen Ämtern, sondern sozusagen stets im Zentrum des Geschehens stand. Gleich nach der Wende für vier Jahre als Justizstaatssekretär im Amt, hat er, unterbrochen nur durch eine Anwaltstätigkeit 2002 seine heutige Funktion in der Staatskanzlei übernommen, die er damit schon seit 23 Jahren ausübt. Und man hat ihn sozusagen über das Renteneintrittsalter hinaus – er weiß gar nicht, wann das ist – damit geködert, dass er auch noch Kulturminister geworden ist.
Ich persönlich darf mich bedanken für sehr viele Gespräche in diesem Vierteljahrhundert. Allerdings werden wir heute mit Markus Bauer – dem letzten Gast auf unserem Podium – ein sehr streitiges Thema mit Herrn Robra auszutragen haben, wo wir, d.h. die Landkreise, im Recht sind und das Land Sachsen-Anhalt himmelschreiendes Unrecht walten lässt. Das darf nicht unausgesprochen bleiben, hat uns aber menschlich nicht auseinandergebracht.
Denn Markus Bauer, Landrat des Salzlandkreises, ist aktuell eine unserer beiden Gallionsfiguren in einem Musterprozess beim Bundesverfassungsgericht zur Sicherung der finanziellen Mindestausstattung der Landkreise. Markus Bauer ist aber vor allem auch Vizepräsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt, und tritt hier heute an für Götz Ulrich, der sich große Verdienste um die Veranstaltung erworben hat, und es sehr bedauert, krankheitsbedingt nicht bei uns sein zu können.
Damit wollen wir in die Diskussion starten!
Diskussion
Die Wiedereinführung der kommunalen Selbstverwaltung in Ostdeutschland
Henneke: Unser erstes Thema heute ist die Wiedereinführung der kommunalen Selbstverwaltung in Ostdeutschland. Dazu hat Werner Henning, 34 Jahre lang Landrat im Thüringer Landkreis Eichsfeld aus Anlass seiner Verabschiedung im Sender Phoenix gesagt: „Das größte Erlebnis der gesamten Nachwendezeit ist die Wiedereinführung der kommunalen Selbstverwaltung“. Frau Lieberknecht – Sie haben die Wendezeit sehr aktiv miterlebt: Stimmen Sie dieser Aussage zu?
Lieberknecht: Ja, es war auf jeden Fall eine wirklich tolle und einmalige Zeit. Die Kommunalwahlen waren aber nicht die ersten freien Wahlen, sondern wir hatten zuvor die erste (und letzte) freien Volkskammerwahl in der DDR vom 18.3.1990. Diese Wahl war wirklich ein Plebiszit der Menschen, auch mit einer großen Wahlbeteiligung, die einfach den schnellen Weg zur Einheit Deutschlands wollten, die Helmut Kohl vertrauten und deshalb die „Allianz für Deutschland“ und namentlich die CDU mit einem wirklich großen Vertrauensvorschuss ausgestattet haben.
 Christine Lieberknecht, Ministerpräsidentin von Thüringen a.D. (links) im Gespräch mit Prof. Dr. Hans-Güter Henneke
Christine Lieberknecht, Ministerpräsidentin von Thüringen a.D. (links) im Gespräch mit Prof. Dr. Hans-Güter Henneke
Viele Beobachter von außen haben nicht erwartet, dass es so kommt. Aber wer im Land gelebt hat, wer in diesen Tagen vor den Wahlen durch die Dörfer gegangen ist, wer die Plakate gesehen hat, der hatte schon ein Gefühl dafür, dass es ein Votum für eine schnelle Einheit in Deutschland werden würde.
Die ersten freien Kommunalwahlen fanden dann am 6.5.1990 statt und waren im Grunde eine Wiederholung der von Wahlbetrug geprägten Kommunalwahlen vom 7.5.1989, die einer der Katalysatoren für die wachsende Unzufriedenheit war. Seinerzeit haben viele, die bis dahin dem Staat der DDR relativ loyal gegenüberstanden, gesagt: Nein, einen solchen Betrug – der nicht das erste Mal vorkam, aber der das erste Mal systematisch nachgewiesen werden konnte – den machen wir wirklich nicht mehr mit.
Das eigentlich Bemerkenswerte dieser Kommunalwahl war aber, dass sie die Ergebnisse der Wahl vom 18.3.1990 bestätigt hat, also ein ebenso klares Votum für die CDU erbracht hat. Das gilt zumindest in Mitteldeutschland, also in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen und hat dazu geführt, dass in Thüringen in allen der damals noch 35 Landkreise ein Landrat von der CDU gewählt wurde – gewählt allerdings nicht direkt von der Bevölkerung, sondern seinerzeit noch von den Kreistagen. Ähnlich war die Lage bei den kreisfreien Städten: In vier von ihnen gab es CDU-Oberbürgermeister und nur in Jena einen von der FDP. Nicht, weil die FDP in Jena so viele Stimmen hatte, sondern weil der Kandidat dieser Partei, Peter Röhlinger, sich als der durchsetzungsfähigste erwiesen hat und sein Amt dann ja auch mit Bravour und über mehrere Legislaturperioden hinweg ausgefüllt hat.
Für mich wichtig: Es war wirklich ein einzigartiger Aufbruch für die Demokratie in der Breite, auch für die täglichen Angelegenheiten der Menschen vor Ort. Beispiel Thüringen: 2,4 Millionen Einwohner, ein kleines Land mit 1.707 Gemeinden, davon etwa 1.300, die unter 1.000 Einwohner hatten, und nochmal etwas über 900 Gemeinden mit unter 500 Einwohnern. Aber sie alle hatten damals mit dieser Wahl vom 6.5.1990 einen Bürgermeister, der sich hauptamtlich für ihre Kommune vor Ort einsetzte. Die einen machten das besser, die anderen waren vielleicht nicht so flink, manche waren auch schwarze Schafe, aber sie machten es. Hinzu kamen die Angehörigen der Gemeinderäte, ebenfalls demokratisch gewählte Mandatsträger. Diese konnten loslegen, konnten sich ins Auto setzen, um zu Norbert Blüm, Horst Waffenschmidt oder anderen nach Bonn zu fahren, die gerade Geld hatten, machten dort Shake Hands und konnten etwas für ihre Kommune erreichen. Das war Demokratie, so wie es die Leute wollten, so wie sie es verstanden.
Diese Art des Handelns war natürlich auf Dauer nicht kompatibel mit den ganzen Regelungen, die man dann später lernen musste. Und wenn ich sage, dass wir heute nur noch 605 eigenständige Kommunen haben, wissen wir, was da abgebaut worden ist in drei Jahrzehnten. Gerade im Eichsfeld war man übrigens ganz besonders fix und hat Dinge geregelt, die ihnen später niemand mehr wegnehmen konnte und die einzigartig waren. Von daher stimmt die Einschätzung von Landrat Henning absolut.
Henneke: Rainer Robra war als Justizstaatssekretär an der Ausarbeitung der Verfassung von Sachsen-Anhalt beteiligt, die auch das Recht der kommunalen Selbstverwaltung regelt, und musste sich 2017 vom Bundesverfassungsgericht bescheinigen lassen, dass diese Regelung gegen Art. 28 Abs. 2 GG verstößt und verfassungswidrig ist. Als wir beide seinerzeit unmittelbar nach der Entscheidung dazu sprachen, meinte er zu mir, das sei das Allerletzte, dass Karlsruhe sage, die kommunale Selbstverwaltungsgarantie in Sachsen-Anhalt verstoße gegen das Grundgesetz. Wie haben Sie denn den Aufbruch damals erlebt? Genauso emotional oder nüchterner?
Robra: Ja, natürlich. Ich bin im November 1990 unmittelbar nach Gründung der Landesregierung Staatssekretär geworden und mein Fokus war insofern ein etwas anderer, als ich die einzigartige und herausfordernde Aufgabe hatte, den sogenannten sozialistischen Rechtsstaat umzuwandeln in einen Rechtsstaat nach dem Leitbild des Grundgesetzes. Ich musste also die Auswahl der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit organisieren, die durch pluralistisch besetzte Ausschüsse erfolgte, die darüber entscheiden mussten, wer glaubwürdig den neuen Rechtsstaat repräsentieren kann und wer nicht.
Darüber hinaus bin ich durch die kleineren und mittleren Städte des Landes gereist, um Kreisgerichte zu schließen und etwas größere Amtsgerichte aufzubauen, später dann die Struktur nach dem Gerichtsverfassungsgesetz. Der spätere Präsident des Oberlandesgerichts war erst amtierender Präsident des Bezirksgerichts Magdeburg, in der Leitung betraut mit dem Aufbaustab des Oberlandesgerichtes, das waren fließende Übergangsprozesse.
Trotzdem habe die Geschehnisse auf der kommunalen Ebene sehr wohl mitverfolgt. Der erste Innenminister, Braun, zuvor Anwalt hier in Magdeburg, war wenig erfahren, verfügt aber mit Hans-Peter Mahn über einen sehr erfahrenen Staatssekretär, der zuvor die Kommunalabteilung im Niedersächsischen Innenministerium geleitet hatte. Von diesem habe ich gelernt, wenn es im politischen Raum Vorwürfe gegen die Kommunen gab: Lasst doch die Leute zufrieden, kommunale Selbstverwaltung kann man sich nicht anlesen, kommunale Selbstverwaltung muss man leben und lebend lernen. Und mit diesem kommunalaufsichtlich betrachtet großzügigen Zugriff hat sich dann tatsächlich dieser Lernprozess in Windeseile vollzogen, die Kommunen wurden immer eigenständiger.
Eine große Rolle spielt damals auch die Frage nach der Übernahme von Kommunalvermögen, z.B. großen Schlössern. Viele kommunale Repräsentanten hatten seinerzeit den Wunsch, sich selbst darum zu kümmern und haben sich damit übernommen. Nur wenige, die sich im Nachhinein als hellseherisch erwiesen haben, haben dafür plädiert, dass solche Gebäude vom Land übernommen werden. Konkret erinnere ich mich an das riesige Schloss in Zeitz. Das wollte die Kommune unbedingt haben, obwohl jeder wusste, es wird auf Dauer nicht gut gehen. Und trotzdem hat Mahn gesagt: Lasst die machen, die werden schon sehen, wie sie damit klarkommen. Dieser auch von einer gewissen Großzügigkeit als neue Landesregierung geprägte Prozess, diese Entwicklung als Übergang zu gestalten, dabei auch Fehler in Kauf zu nehmen und zuzulassen, trotzdem nicht den Mut zu verlieren, auch immer wieder zu ermuntern mit dem Hinweis, dass kommunale Selbstverwaltung wichtig ist und erlernt werden muss – das ist etwas, das bei mir wirklich haften geblieben.
Den Parlamentarischen Staatssekretär Waffenschmidt kenne ich übrigens auch noch. Das war derjenige, der große Kommunalversammlungen durchgeführt hat, sich von den Besucherinnen und Besuchern hat vortragen lassen, wo das Problem ist, und dann seinem beachtlichen Referentenstab zurief: Welches Programm haben wir denn für dieses Problem und schon floss der Rubel wieder.
Henneke: Kommen wir zu Markus Bauer. Wäre Götz Ulrich heute hier, hätte ich ihn daran erinnert, dass mein allererster bundesweiter Auftritt – ich war damals noch in Diepholz tätig – aus Anlass einer Landkreisversammlung im ehemaligen, zwischenzeitlich im Burgenlandkreis aufgegangenen Landkreis Nebra – stattgefunden hat. Gastgebender Landrat war der Vater von Götz Ulrich. Und Nebra selbst war mit gut 2.000 Einwohner seinerzeit die kleinste Kreisstadt Deutschland. Das erinnert an das, was Frau Lieberknecht eben gesagt hat.
Markus Bauer, wir haben Sie diesen Übergang aus dem DDR-Regime in die kommunale Selbstverwaltung erlebt? Sie waren damals noch nicht im Amt, dafür waren Sie zu jung, aber Sie werden sicher Erinnerungen an die Strukturen haben und etwas dazu zu sagen können, welche Auswirkungen diese bis heute haben.
Bauer: Zunächst vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute zu Gast zu sein. Auch Dir, lieber Heinz-Lothar Theel, nochmals ganz persönlich Dank für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Aber zurück zu Ihrer Frage: Ich war zur Wende 18 Jahre alt, kann mich aber noch gut daran erinnern, dass wir – ich bin in der katholischen Kirchengemeinde groß geworden und dort immer noch verwurzelt –, kurz zuvor ein Plakat vor das Rathaus gestellt haben, auf dem stand: Wir sind das Volk. Damals wurde es über Nacht weggenommen, wir sind ins Pfarrhaus, in unser Jugendzimmer, und haben ein zweites Plakat gemalt, auf dem stand: Wir sind trotzdem das Volk, und haben es wieder hingestellt. Das ist für mich eine prägende Erinnerung.
Zur Äußerung des Kollegen aus Eichsfeld würde ich daher vor diesem Hintergrund sagen, dass der Blick auf die Ereignisse damals auch davon abhängt, wie alt man war, was man erlebt hat. Für mich gab es neben der Wiedereinführung der kommunalen Selbstverwaltung auch noch viele andere Schritte nach der Wende, zum Beispiel das Vereinsrecht, das wieder etabliert wurde, dass ein Verein sich wirklich selbstständig aufbauen und sich jeder entsprechend seinen Neigungen und Bedürfnissen einbringen kann – das war mir wichtig.
 Markus Bauer, Landrat des Salzlandkreises (links) und Prof. Dr. Martin Burgi
Markus Bauer, Landrat des Salzlandkreises (links) und Prof. Dr. Martin Burgi
Ich war nach der Wende viele Jahre weg und bin erst 2001 zurückgekehrt, um mich in meiner Heimatstadt Nienburg als ehrenamtlicher Bürgermeister zur Wahl zu stellen. Ich habe gedacht, die müssen mich da alle noch kennen, es hat sich aber auch gezeigt, dass zehn Jahre Wegsein, auch viel Abstand bringt. Mit Abstand meine ich jetzt gar nicht, dass ich anders dachte oder anders gewesen bin, sondern, dass man sich immer wieder einbringen muss. Denn kommunale Selbstverwaltung hat – dies vielleicht als kleiner Seitenhieb – auch etwas mit Vertrauen zu tun. Wenn ich kommunal verwalten soll, kommunal entwickeln soll, dann brauche ich dafür natürlich auch die Möglichkeiten. Es braucht also eine auskömmliche Finanzausstattung, aber auch die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen, damit gestaltet werden kann.
Es gibt bei uns viele Landräte und Bürgermeister, die nach der Wende etwas geschafft und ihre Handschriften hinterlassen haben. Das war, Frau Lieberknecht hat es beschrieben, seinerzeit auch noch einfacher. Ich glaube, dass wir uns heute wieder in diese Richtung bewegen müssten. Wir müssten die Kommunen besser ausstatten und wieder mehr darauf vertrauen, dass sie die Probleme vor Ort lösen können. Ich bin 2001 unter dem Motto: „Ohne Begeisterung ist nie was Großes entstanden“ in die Kommunalpolitik gegangen. Ich glaube bis heute, dass man begeistert sein muss. Man darf nicht in Wahlperioden denken und sich auf das konzentrieren, was in vier Jahren, in sieben Jahren zu schaffen ist, sondern muss lernen, damit zu leben, Ziele zu definieren, die am Ende erst die eigene Nachfolgerin oder der Nachfolger umsetzt. Ich glaube, das kann auch eine Chance sein im Miteinander, und das ist auch das, was ich erlebe, das klappt am besten, wenn man nicht zu weit weg ist.
Henneke: Herr Burgi, aus Ihrer Perspektive: Was hat die Einführung des Systems der kommunalen Selbstverwaltung in den neuen Bundesländern für das deutsche Kommunalrecht bewirkt? Die Regelungen wurden ja vielfach aus Westdeutschland übernommen, aber hat es dann auch eine gesamtdeutsche Weiterentwicklung gegeben?
Burgi: Im Gegensatz zu den vorherigen Rednern bin ich kein Zeitzeuge aus eigenem Erleben. Das heißt, ich habe natürlich diese Zeit miterlebt, aber tief im Westen gewissermaßen. Aber ich habe dort eines gesehen und das kommt, glaube ich, immer zu kurz, wenn man diese Ost-West Thematik behandelt: Ich habe 1989 das zweite Staatsexamen gemacht, im Jahr der Wiedervereinigung. In diesem Jahr sind unendlich viele junge Juristinnen und Juristen, aber natürlich auch gut ausgebildete Ingenieure, Techniker, Mediziner und so weiter in die neuen Bundesländer gewandert. Mich hat immer ein bisschen betrübt, dass man diese später als „Wessis“ oder gar als „Besserwessis“ tituliert und ihnen unterstellt hat, sie seien nur deshalb gekommen, um schneller Karriere zu machen.
In Wirklichkeit waren das eigentlich, wenn ich jetzt mal die Menschen aus meinem eigenen Jahrgang Revue passieren lasse, das waren eher die Mutigeren, die aus der Komfortzone heraus wollten, die genau das angelockt hat, was Sie eben beschrieben haben, nämlich dass man mehr machen konnte, nicht zu vielen Zwängen ausgesetzt war, dass man Erfolge erzielen konnte, so dass das Geld am Anfang in der Tat vielleicht nicht die gleiche Rolle gespielt hat. Das waren also nicht die Schlechtesten, sondern ganz im Gegenteil, möglicherweise eher die Mutigen, und in der Folgezeit hat dieser ständige Austausch – einige sind dann wieder zurück, andere sind neu dazugekommen – dazu geführt, dass Ideen und Ansätze aus dem Osten im Westen übernommen wurden. Das gilt z.B. für die interkommunale Zusammenarbeit, die Kooperation.
Ich glaube, das war ein ganz starker Impuls. Die neuen Bundesländer hatten von Anfang an aufgrund der Kleinteiligkeit mehr den Zwang zu kooperieren. Nachbargemeinden haben kooperiert, Kreise kooperierten ebenso, und interessanterweise wurde auch mit Privaten kooperiert. Letzteres gilt gerade in Bereichen wie der Abwasser- oder der Abfallentsorgung. Während in den westdeutschen Ländern eine solche Zusammenarbeit mit Privaten lange Zeit als ein etwas Ungutes und Heikles erschien, hat man die Dinge im Osten weniger dogmatisch betrachtet.
Noch eine weitere Beobachtung möchte ich beisteuern: Wir sind in Deutschland nicht die einzigen, die historische Umbrüche erlebt haben, in denen sich auch die Frage stellte, wie das auf der kommunalen Ebene läuft. Ich bin seit vielen Jahren wissenschaftlich sehr viel auch in Spanien unterwegs. Spanien hat noch vor der deutschen Wiedervereinigung einen ganz großen Umbruch erlebt, und zwar mit dem Ende des Franco-Regimes und dem Entstehen dessen, was wir heute als freiheitlich-demokratisch-rechtsstaatliches Spanien kennen. Es wird hier niemanden überraschen, wenn ich sage, dass man dort genau so verfahren ist, wie in Deutschland. Man hat in die Verfassung eine Garantie der kommunalen Selbstverwaltung aufgenommen, es gibt heute Städte und Gemeindeverbände, es gibt Institute an Universitäten, die sich mit dem Kommunalrecht befassen. Das heißt: Auch Spanien fundiert auf der kommunalen Selbstverwaltung, und zwar genau aus dem gleichen Impuls heraus. Deswegen rate ich auch sehr dazu, immer diese internationale Perspektive einzubeziehen.
Wir Kommunalen, wenn ich das so sagen darf, sind nicht allein. In Frankreich gibt es heute mehr kommunale Selbstverwaltung als vor 40 Jahren, in Italien und Österreich gibt es natürlich sehr viel kommunale Selbstverwaltung und in Spanien, wie gesagt, ist es ganz signifikant, das heißt, wir haben einen gemeinsamen Schatz und ich glaube, wir alle werden stärker, wenn wir uns dieser Gemeinsamkeit vergewissern.
Kommunale Gebietsreformen
Henneke: Jetzt haben wir den Übergang vom Zentralismus zur kommunalen Selbstverwaltung in sehr kleinen Gemeinden und Landkreisen beschrieben. Ab 1994 kommt es dann in den neuen Ländern zu einer Welle von kommunalen Gebietsreformen. In Sachsen-Anhalt waren es am Ende sogar zwei Kreisgebietsreformen sowie eine Gemeindegebietsreform. In Thüringen gab es eine Kreisgebietsreform, an der zweiten ist man dann gescheitert. Auch zu diesem Thema möchte ich jeden von Ihnen um seine Einschätzung bitten und mit Herrn Robra anfangen wollen. Hat diese Gebietsreform, Herr Robra, die die verwaltungsorganisatorische Komponente stärker in den Blick genommen hat, hat sie die in den ersten vier Jahren gewachsene Demokratie und die Identität des Raumes, die sich ja auch herausbilden musste, zerstört oder hat sich das bewährt? Bedarf es ggfs. weiterer Reformen?
Robra: Wenn ich die kommunalen Praktiker hier im Raum betrachte, gehe ich davon aus, dass es dazu heute sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt, die auch sicherlich regional geprägt sind.
Die erste Kreisgebietsreform in der ersten Legislaturperiode war aber relativ unstrittig. Ich habe den damaligen Innenminister – das war der aus Hamburg kommende Hartmut Perschau – dafür bewundert, wie er in Windeseile jede örtliche Verbindungsstraße im Blick hatte und wusste, wo ein unbeschrankter Bahnübergang die Vereinigung von Kreisgebieten hinderte und wie man es zusammenfügt. Diese erste Kreisgebietsreform war vergleichsweise bescheiden und ich glaube nicht, dass die ersten CDU-Ministerpräsidenten wegen dieser Kreisgebietsreform von Reinhard Höppner abgelöst wurden; das hatte ganz andere Gründe.
Die zweite Kreisgebietsreform war insgesamt schwieriger. Dazu hatte ich mich mit Wolfgang Böhmer irgendwann einmal darauf verständigt, dass wir das in der ihm eigenen Weise sehr schrittweise entwickeln. Das erste Gesetz, das wir dementsprechend in den Landtag eingebracht haben, hieß „Kreisgebietsneugliederungsgrundsätzegesetz“. Dieses enthielt nur relativ abstrakte Kriterien, die keiner so richtig auf die örtlichen Gegebenheiten runterbrechen konnte. Jedenfalls im Parlament lief das gut. Damit hatten wir ein Raster. Intern war die Vorgabe, bloß keine Karten zu zeichnen. Wer die erste Karte zeichne, der habe schon verloren.
Die Kreisgebietsstruktur, die wir als Ergebnis der zweiten Reform heute noch haben, ist nach meinem Empfinden jetzt relativ akzeptiert, zumal jeder weiß, dass der nächste Schritt nach einer inneren Sachlogik im Land Sachsen-Anhalt zu einer Vierergliederung führen müsste. Das wäre ähnlich wie Mecklenburg-Vorpommern, wo ja auch schon einmal so große Kreise gebildet werden sollten. Das wäre aber bei uns in der Altmark gar nicht realisierbar. Das will niemand. Deswegen bin ich da sehr sicher, dass die Kreisstrukturen bleiben.
Die Gemeindegebietsneugliederung folgte dann in der dritten Legislaturperiode in einer scheinbar ähnlich unübersichtlichen, aber durchdachten Schrittfolge. Das Gemeindeneugliederungsgrundsätzegesetz wurde verabschiedet, aber das eigentliche „Aha-Erlebnis“ stellte sich erst ein, als klar wurde, was das in der Praxis bedeutete. Die Ergebnisse waren für viele überraschend. Das war ein schwieriger Lernprozess, ein schwieriger Gewöhnungsprozess für alle Beteiligten, zumal wir ja nicht nur die Gebiete verändert, sondern auch neue Strukturen wie Verbandsgemeinden geschaffen haben.
Die erste Phase der Delegation von Verwaltungsaufgaben auf die Kreise nach der zweiten Kreisgebietsneugliederung erfolgte relativ zügig und in der Rückschau auch relativ konfliktfrei. Wir haben ein straffes Konnexitätsprinzip im Lande Sachsen-Anhalt, aber immer schon auch sehr großzügig mitdenkende Landräte und Hauptgeschäftsführer des Landkreistages und wir konnten uns auf eine Interessenquote bei den Kreisen verständigen, die es auch für das Land attraktiv macht, einer Aufgabe herunterzugeben.
Viele haben gesagt, das ist zu wenig, das reicht nicht, das müsste noch mehr werden. Inzwischen wissen wir, dass das unter den Kreisgebietsreformen und Verwaltungsreformen, die diesen Kreisgebietsreformen folgten, diese die relativ weitestgehende war. Alles was später kam, war noch ärmlicher. Das steht weiter auf der Tagesordnung, insbesondere die interkommunale Funktionalreform hat nicht wirklich stattgefunden.
Wir wissen alle, wie der Zustand der Bürokratie in Deutschland ist. Aus meiner Sicht ist eine neue Verwaltungsreform insgesamt als wichtige Randbedingung zur Entbürokratisierung unverzichtbar, aber mittlerweile schwebt das Konnexitätsprinzip wie ein Damoklesschwert über uns und wenn eine Aufgabe, die auf Landesebene von dreien wahrgenommen wird, dann auf der kommunalen Ebene hinterher von 13 wahrgenommen und vollkommen vom Land finanziert werden muss, dann gibt es einfach finanzielle Grenzen dessen, was man vernünftigerweise tun kann. Ich hoffe, dass wir da im Laufe der Zeit noch zu neuen Einsichten gelangen.
Henneke: Herr Bauer, sind Sie mit Ihrem zusammengeschnittenen Gebiet zufrieden? Sind Verwaltungsleistungskraft und Ehrenamt vernünftig austariert und die Schmerzen aus Gebietsreformen überwunden?
Bauer: Schmerzen, was ist das? Also zufrieden, das ist ja immer so eine Frage – als würde man sich in den Sessel setzen und sagen: Alles erledigt.
Ich glaube, ich habe mal zum Neujahrsempfang gesagt, wenn der Rückspiegel größer wird als die Frontscheibe, wird es schwierig. Es ist gut, zurückzuschauen und sich zu fragen, was man erlebt hat, was gut und was vielleicht nicht so gut war. Aber man muss auch nach vorne schauen. Und insoweit würde ich sagen, die Botschaft, jetzt auch nur noch einmal an eine weitere Gebietsreform zu denken, wäre kein gutes Zeichen. Das will ich gerne begründen.
Ich bin in einer kleinen Stadt groß geworden, damals gab es noch die Bezirke Halle und Magdeburg und die Bezirksgrenze hat man am Asphalt bemerkt. Der Asphalt auf der einen Seite war so und der andere Asphalt war dann anders. Und außerdem haben die Menschen jenseits der Bezirksgrenze auch anders gesprochen. Diese sozialen Strukturen sind auch nach der Gebietsreform erhalten geblieben. Wenn man mit dem Auto zum Einkaufen immer nach links gefahren ist, hat man dies auch nach der Gebietsreform so gemacht. Auch an die neuen Einzugsgebiete von Schulen oder Sportvereine musste man sich erst gewöhnen. Das war ein langer Prozess.
Meine Tochter ist 25 und weiß zumindest aus eigener Erfahrung nicht mehr, dass es mal einen Kreis Bernburg gab. Wir können gerne darüber philosophieren und die Historie bedienen, aber ich glaube, die Jugend, die jetzt dann groß wird, hat etwas anderes kennengelernt, als wir es noch kennen. Ich glaube, es ist auch gut, soziale Strukturen aufzubauen und das hat auch etwas wieder mit Verlässlichkeit zu tun, zu sagen, wo bin ich groß geworden in der Schule, wo habe ich Verbindungen geschaffen, wo baue ich Wirtschaftsbeziehungen auf. Das sollte man nicht leichtfertig wieder in Frage stellen.
Das hat auch etwas zu tun mit der Aussage: Hier bin ich zu Hause und zufrieden. Ein Redakteur hat mich mal gefragt, warum der Landkreis immer noch nicht eins geworden sei. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass es doch gar nicht das Ziel sein könne, dass überall im Landkreis der gleiche Dialekt gesprochen wird, es überall die gleiche Kultur, die gleichen Sportvereine gibt. Wenn der Karneval in der einen Region eine Hochburg hat, muss er die doch nicht auch in einer anderen Region haben. Wir wollen unterschiedliche soziale Strukturen möglichst zusammenbringen und die Vielfalt in der Region ausbauen, so dass man sagt, da können wir etwas gestalten.
Ich selbst habe drei Gebietsreformen mitgemacht und immer die Idee der Verwaltungsgemeinschaft abgelehnt. Das war für mich eine schreckliche Vorstellung, als direkt gewählter Bürgermeister Verantwortung für einen Haushalt zu übernehmen, der eigentlich vom Verwaltungsleiter der Gemeinschaft erstellt wurde. Die Verbandsgemeinden, die wir jetzt haben, sind ein anderes Modell, trotzdem glaube ich, dass das Thema „kommunale Gebietsreform“ für Sachsen-Anhalt erst einmal tabu sein sollte.
Henneke: Und da ist jetzt Kronzeugin Christine Lieberknecht mit einer durchgeführten und einer – wie sie aus dem Ruhestand beobachten konnte – am Ende gescheiterten Kreisgebietsreform. Heute hat Thüringen mit 17 die meisten Landkreise in Ostdeutschland. Geht auch so, oder?
Lieberknecht: Es mag sein, dass wir die meisten Landkreise in Ostdeutschland haben. Das ist aber nicht unser Maßstab. Die Thüringer wissen, dass sie mal mehr Residenzen hatten als heute Landkreise. Hinter diese 17 will jedenfalls keiner mehr zurück; dass es früher 35 waren, ist Geschichte.
Ich glaube, es hat schon einen guten Grund, dass wir die Fragen des Kommunalrechts oder der kommunalen Gliederung in die Kompetenz der Länder gegeben haben, weil Landschaften in Deutschland doch sehr unterschiedlich sind. Und die über Jahrhunderte geprägte Kleinteiligkeit Thüringens hat natürlich auch ganz klar etwas mit der thüringischen Landschaft zu tun. Freiherr vom Stein hatte schon Recht, als er sagte: Die Kenntnis des Ortes ist die Seele des Dienstes. Man muss schon sehen, wer zusammenpasst.
Die erste Gebietsreform war als solche nicht umstritten war. Es war klar, dass wir wegen aller möglichen Parameter nicht bei 35 werden bleiben können. Trotzdem gibt es Teile der Reform, die gut gelungen sind, weil es passte, aber eben auch Teile, an denen bis heute gehadert wird, weil die betroffenen Gebiete immer von unterschiedlichen Prägungen und Zugehörigkeiten waren. Man mag das irgendwie als nostalgisch und so ein bisschen spinnert bezeichnen, ist es aber nicht. Es sitzt bei den Leuten tief.
Mir ist das bewusst geworden, es hat mich selber überrascht, am Beispiel der Henneberger, ein Grafengeschlecht im Süden Thüringens, Hildburghausen, daneben Sonneberg. Die Henneberger feierten irgendwann in den 90er Jahren das 800-jährige Bestehen ihrer Grafschaft – dabei war das Grafengeschlecht schon vor 500 Jahren ausgestorben. Und sie feierten es trotzdem mit einer Lebendigkeit und natürlich dann auch mit Heimatforschern und Publikationen und einem Volksfest, also mit allem, was dazu gehört.
In dieser Region ist die Kreisgebietsreform tatsächlich schon 1994 gescheitert, mit Sonneberg und Hildburghausen trotz eines überzeugenden Landesvaters Bernhard Vogel, trotz einem Innenminister Franz Schuster, der über Jahre die Kommunalabteilung der Adenauer-Stiftung geleitet hat, und zwar an den sprichwörtlichen Eiern, die dem Schuster in Sonneberg da ins Gesicht geflogen sind. Sie haben es dann gelassen und ein paar andere Dinge hat man dann auch gelassen.
Auch sonst gab es Kompromisse. So wurde bspw. eine neue kreisfreie Stadt – Eisenach – geschaffen, die mittlerweile wieder eingekreist ist, weil es sich nicht bewährt hat. In diesem Fall hatte man auch Glück mit den kommunalpolitischen Vertretern, von denen übrigens eine, die ehemalige Oberbürgermeisterin von Eisenach, jetzt Finanzministerin ist: Katja Wolf. Auch eine Gemeindegebietsreform hat stattgefunden, so dass sich die Zahl der Gemeinden auf 600 reduziert hatte, als die Kommunalordnung in Kraft trat.
Unter Demokratiegesichtspunkten will ich noch daran erinnern, dass die Kreisgebietsreform Heerscharen von Menschen in Bewegung gesetzt hat. Da sind ganze Busse angereist, wenn es um die Nominierung der neuen Landräte ging, die zum Teil unter Beteiligung von 800 Menschen stattfanden.
Wir hatten aber auch andere kommunale Themen, wie in Sachsen-Anhalt sicher auch. Der Begriff „Kommunalabgaben“ z.B. war für DDR-Bürger ein Fremdwort, so etwas kannten wir gar nicht, und auf einmal ging es dann um Anschlussgebühren für Wasser, um Abwassergebühren – und das alles angesichts der großen Grundstücke auf den Dörfern. Das war eine erhebliche Herausforderung für das Land, und in einer solchen Zeit war an eine weitere Gebietsreform nicht zu denken. Für so etwas braucht man gute Argumente. Dabei reicht es nicht aus, aus einer verwaltungswissenschaftlichen Perspektive auf Effizienzgewinne zu verweisen. Man muss auch die sozialen Kosten im Blick behalten – und die sind in größeren Einheiten nicht unbedingt geringer.
Henneke: Aber dann gab es in Thüringen die entsprechenden Argumente und Sie wurden Ministerpräsidentin und hatten den Schlamassel am Hals.
Lieberknecht: Eigentlich war es ja eine intelligente Lösung. Gebietsreformen waren bei uns immer Steckenpferde der SPD. Die wollten zentrale, große Einheiten, die hatten auch nicht die Präsenz auf den Dörfern, während die CDU überall noch ihre Ortsverbände hatte.
Gebietsreformen waren für die CDU immer schwieriger, aber da ich einerseits ein intellektuell interessierter Mensch bin, andererseits mich aber auch nicht scheue, meine Rolle als Politikerin zu spielen, hatte ich keine Skrupel, mit der SPD zusammen Gutachten auf den Weg zu bringen. Deshalb haben wir heute noch die umfassendste Ermittlung sämtlicher Sachstände und verfügen über sämtliche Kreisgebietsdaten, über sämtliche Landesverwaltungsdaten und über die Kommunaldaten. Trotzdem hat sich mir intellektuell nicht erschlossen, warum man die Zahl der Kreise nochmals um die Hälfte reduzieren sollte.
Das war dann im Streit und einer der Gründe, warum die SPD nach der nächsten Wahl schließlich sagte, noch eine Koalition, die rechnerisch möglich gewesen wäre, machen wir mit der CDU nicht. Ich jedenfalls habe es während meiner Regierungszeit trotz Koalitionsdruck durchgehalten, auf der Grundlage des Gutachtens, über das man intellektuell streiten kann, die Kreisgebietsreform nicht anzufassen.
In der neuen Regierung waren sich SPD, Linke und Grüne dagegen über die Durchführung einer Kreisgebietsreform einig. Es wurden tolle Pläne auf den Tisch gelegt, obwohl auch gesehen wurde, dass es vor Ort Widerspruch und Widerstand gab.
Am Ende haben sie es dann so gemacht, dass es nicht rechtsicher war und am Landesverfassungsgericht gescheitert ist. Und Bodo Ramelow, der ja einen Sinn dafür hat, wie die Leute ticken, hat dann entschieden, dass das Thema erledigt ist – und jetzt packt das auch niemand mehr an.
Henneke: Auch in Brandenburg ist ja die zweite Kreisgebietsreform gescheitert, obwohl man einen 20 Jahre amtierenden Vizepräsidenten des Deutschen Landkreistages zum Innenminister gemacht hatte. Doch jetzt die Frage an Martin Burgi: Ist es mit den kommunalen Gebietsreformen jetzt für alle Zeiten vorbei? Braucht es angesichts von Digitalisierung und neuen Formen der Kooperation noch geänderter Gebietszuschnitte?
Burgi: In der Tat hat seit vielen Jahren kein einziges Bundesland mehr ernsthaft den Versuch einer Gebietsreform unternommen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass „Gebietsreform“ heute ein totes Pferd ist, das niemand reiten will und auch niemand reiten sollte, und zwar deswegen, weil die Reiter ganz andere Sorgen haben als eine Gebietsreform.
Reformen dieser Art führen in erster Linie dazu, dass der Apparat mit sich selber beschäftigt ist. Die Kommunen investieren viel Kraft, um eine Reform abzuwenden, und die andere Seite betreibt einen erheblichen Aufwand, um die Reform durchzusetzen. Für eine solche Form der Selbstbeschäftigung werden wir in den nächsten Jahren schlicht keine Zeit haben, sondern müssen uns für andere Dinge einsetzen.
Auch wenn Gebietsreformen definitiv kein Zukunftsthema sind, heißt das nicht, dass es keiner anderweitigen Reformen bedarf. Das Stichwort Funktionalreform wurde schon genannt. Ich glaube, dass man im Verhältnis zwischen Gemeinden und Kreis immer neu nachdenken muss, ob da die Aufgaben richtig verteilt sind. Das ist übrigens, wenn ich jetzt einen kleinen Ausblick geben darf, auch in einem zumindest nach eigener Einschätzung vermeintlich reichen und vollkommen sorgenfreien Bundesland wie Bayern so.
Bayern hat über 2200 Gemeinden, eigentlich auch viel zu viele. Im Vergleich: In Nordrhein-Westfalen sind es 365, obwohl das Land einwohnerstärker ist. Natürlich ist es aber nicht so, dass jede von diesen Gemeinden aus eigener Kraft und Stärke sämtliche anfallenden Aufgaben erledigen könnten. Ein Beispiel dafür ist die Vergabe öffentlicher Aufträge – sehr kompliziert, sehr fehlerträchtig. Was machen die bayerischen Gemeinden? Statt sich an das Landratsamt zu wenden, beauftragen sie eine Münchner Anwaltskanzlei. Das heißt, der Steuerzahler kommt dafür auf, dass diese Kleinstgemeinden nicht in der Lage sind, rechtlich vorgegebene Maßstäbe zu beachten. Selbständigkeit wird also eher behauptet als gelebt. Hier gibt es viel Unehrlichkeit in der Diskussion.
Trotzdem bin ich nicht dafür, dass man eine Gebietsreform durchführt, ich bin auch nicht dafür, dass man den Gemeinden die Aufgabe zwangsweise wegnimmt, aber ich wäre sehr dafür, dass man alles unternimmt an Anreizen, an Fördermaßnahmen, an Parametern im Finanzausgleich, um sie dazu zu bringen, entweder untereinander zu kooperieren oder die Aufgabe dem Kreis zu übertragen.
Letzter Punkt: Ich fand sehr interessant, was Herr Robra zum Thema Konnexität gesagt hat. Wir alle hier sind sicher Anhänger des Konnexitätsprinzips, aber vielleicht muss man doch einen Unterschied machen zwischen der Normallage, in der ein Land den Kommunen einzelne Aufgaben überträgt und in der das Konnexitätsprinzip fraglos gelten muss, und einer kompletten Funktionalreform, in der gewissermaßen das ganze System neu justiert wird. Wenn ich dort den gleichen Maßstab ansetze, werde ich nie mehr Funktionen verschieben können.
Mich erinnert das ein bisschen an Art. 14 GG, also an die Eigentumsgarantie. Dort wird auch zwischen der entschädigungspflichtigen Enteignung in einem einzelnen Fall und einer sogenannten Neubestimmung des Inhalts des Eigentums unterschieden, durch die das gesamte Zuordnungssystem geändert wird.
Ich bin nicht dafür, dass man Zuordnungssysteme über Nacht ändert, aber wir können diese beiden Maßnahmen, so glaube ich, nicht an dem gleichen Maßstab messen, zumindest ist das eine Diskussion, die man – anders als diejenige über Gebietsreformen – definitiv führen muss.
Kommunale Finanzausstattung
Henneke: Das war, ohne dass wir das abgesprochen haben, eine gelungene Überleitung zum Thema Geld. Dass man durch Geld Zusammenarbeit fördern kann, das haben wir in Deutschland auf der Kreisebene bislang nur einmal erlebt, und zwar beim freiwilligen Zusammengehen der Landkreise Osterode und Göttingen in Niedersachsen.
Und damit zu Markus Bauer und seinem Landkreis, der demnächst pleite sein wird. Warum ist das so? Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Ausgangspunkt ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2013. Das Gericht hat seinerzeit ganz zu Recht festgehalten, dass alle Kommunen einen Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung haben, der sich allerdings – bei den Gemeinden – nicht nur gegen das Land richtet, sondern der auch seitens der Kreise bei der Festlegung der Kreisumlage zu berücksichtigen ist. Der eigentlich zwischen den Gemeinden und den Landkreisen auf der einen und dem Land auf der anderen Seite zu führende Streit um die finanzielle Mindestausstattung der kommunalen Ebene wird auf diese Weise verlagert und belastet seither das Verhältnis von Gemeinden und Kreis, zumal findige Rechtsanwälte Klagen gegen die angeblich fehlerhafte Festsetzung von Kreisumlagen als Geschäftsmodell für sich entdeckt haben.
So liegen die Dinge auch im Landkreis Mansfeld-Südharz oder im Salzlandkreis, die nun ihrerseits versuchen müssen, ihren Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung gegenüber dem Land gelten zu machen. Das Land wiederum verwahrt sich gegen solche Ansprüche mit dem Verweis auf seine eigene mangelnde Leistungsfähigkeit.
Ob und in welchem Umfang es dies darf, wird nun das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden haben, vor dem die genannten Landkreise – übrigens im Einvernehmen mit dem Land – geklagt haben. Denn klar ist ja: So, wie es gegenwärtig ist, kann es nicht bleiben. Das System funktioniert schlicht nicht.
Darüber müssen wir nun noch einmal sprechen. Was erwarten Sie sich, Herr Bauer, und werden Sie sich hinterher wieder vertragen?
Bauer: Ich habe vor allem die Hoffnung, dass Klarheit geschaffen wird. Wir müssen wissen, wie wir in Zukunft und mit welchem Budget arbeiten können. Dabei habe ich insbesondere auch unsere freiwilligen Aufgaben im Blick, die ohnehin nur noch eine kleine Rolle spielen, obwohl sie für die Selbstverwaltung so wichtig sind, während wir überwiegend uns übertragene Aufgaben zu erfüllen haben.
Vor allem müssen die ständigen Streitigkeiten um die Kreisumlage beendet werden. Es ist uns in meinem Kreis in der Vergangenheit durchaus gelungen, auch Fehlbeträge zurückzuführen. Dafür braucht man aber Zeit und Geduld. Dann aber kam die Klagewelle und das hat uns völlig gelähmt.
Wir schauen heute nur noch darauf, wie wir die Kreisumlage rechtssicher gestalten. Statt mit den Gemeinden darüber zu sprechen, wie wir uns gemeinsam – Landkreise und Gemeinden – in den nächsten Jahren entwickeln wollen, müssen wir uns vor allem gegen den Vorwurf wehren, den Gemeinden zu viel wegzunehmen. Das belastet unser Verhältnis und schadet der kommunalen Selbstverwaltung. Deshalb muss das Bundesverfassungsgericht hier für Klarheit sorgen.
Robra: Das habe ich verstanden, und zwar schon lange, deswegen gehen wir da ja auch sehr konstruktiv miteinander um.
Nochmal eine kleine Nachbemerkung zu den Ausführungen von Herrn Burgi und den von ihm angemahnten Paradigmenwechsel. Was die meisten gar nicht wissen: Das gesamte Sozialleistungsrecht diffundiert hin zu freien Trägern. Ich habe das in meiner Begrüßung mit dem spöttischen – allerdings authentischem Begriff – des Job-Buddy ja schon einmal angedeutet. Solche Programme werden vom Bund geregelt, dann ausgeschrieben, freie Träger können sich bewerben, bekommen den Zuschlag und die erforderlichen Finanzmittel. Auf diese Weise entsteht eine Sozialleistungsstruktur neben den Kommunen und neben dem Land, die parlamentarisch oder politisch nur sehr eingeschränkt verantwortlich ist. Das müssen wir beenden und wieder dazu kommen, dass diese Aufgaben im Verbund von Staat und Kommunen wahrgenommen werden und nicht in extrem teure Parallelstrukturen abwandern, bei denen wir nie im Leben jemals eine Effizienz Rendite werden erkennen können.
Doch zurück zum Thema. Hier ist es in der Tat so, dass wir es mit einer – nicht nur in diesem Bereich – verhängnisvollen Verrechtlichung politischer Prozesse zu tun. Das ist das zentrale Problem.
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 GG abgeleitet Parameter mit Bindungswirkung für die Verwaltungsgerichte definiert, die die Räume für das Landesparlament, den einfachen Gesetzgeber, extrem eng machen, weil ja jeder dieser Punkte sozusagen den Veredelungsstempel „Art. 28 GG“ auf der Stirn trägt. In der Sache geht es darum, die parlamentarisch-politische Verantwortung für dieses zentrale Thema des Verhältnisses zwischen Land und Kommunen einerseits und auf der kommunalen Ebene zwischen Kreisen und Gemeinden andererseits zurückzugewinnen, denn es sind eminent politische Prozesse.
Wie wir das Verhältnis zwischen den Gemeinden und den Kreisen regeln, das muss das Parlament entscheiden. Insoweit gelten der Parlamentsvorbehalt, die Wesentlichkeitstheorie. Wenn dann ein Delta bleibt in der Finanzierung, ist natürlich das Land gefordert, denn wir können, auch nach unserer Verfassungslage, die kommunale Ebene nicht aushungern. Deshalb gibt es im Landtag nochmal Bemühungen, das, was die Rechtsprechung gesagt hat, irgendwie im Gesetz umzusetzen. Ich kenne die dahinterstehenden finanziellen Kalkulationen noch nicht und weiß nicht, ob es tatsächlich rückstandsfrei aufgeht oder ob da doch noch wieder dieses Delta bleibt, in das das Land hineinspringen muss.
Gleichwohl bleibt die angestrebte, und da sind wir uns ja einig, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wichtig, um auch mal klarzumachen, was denn nun Art. 28 GG wirklich aus sich selbst heraus gebietet und wie weit die sonst bei solchen Gelegenheiten von den obersten Bundesgerichten gepriesene Einschätzungsprärogative des Landesgesetzgebers, des einfachen Gesetzgebers, reicht bzw. wo sie dann eben tatsächlich endet.
Im Augenblick ist es aber tatsächlich so, dass die Kreise wirklich lange nach vorn oder aber eben lange zurückschauen müssen, um zu verifizieren, wie viele ihrer Gemeinden tatsächlich, wie wir das in anderen Zusammenhängen nennen, „unter Wasser“ sind, und ihre Aufgaben, vor allen Dingen auch den letzten Rest freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben, nicht mehr angemessen wahrnehmen können. Was das für die Festsetzung der Kreisumlage als der wichtigsten Finanzierungsgrundlage der ja sonst im Steuererfindungsrecht den Gemeinden nicht annähernd gleichgestellten Kreise bedeutet, das muss man ausloten. Ich hoffe, dass das jetzt gelingt, denn für uns ist die Kreisebene extrem wichtig.
Zum Abschluss will ich noch einmal auf Herrn Burgi eingehen. Wir müssen tatsächlich noch mehr Aufgaben vom Land auf die Kreise – von mir aus auch stellvertretend auf nur einen Kreis, der dann für die anderen Kreise tätig wird – delegieren können. Kommunale Zusammenarbeit ist ja grundsätzlich möglich. Damit sind keine besonderen juristischen Herausforderung verbunden, man muss es eben nur wollen.
Ein Anwendungsfall dafür könnte die Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sein. Es gibt Länder – z.B. Bayern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe –, die haben diese Aufgabe einer Bezirksregierung stellvertretend für alle anderen übertragen. Aus meiner Sicht gehört das in die Trägerschaft eines Kreises, der sich dann mal so richtig reinfuchsen kann in diese ganzen Herausforderungen – also: wie kann man mit den Konsulaten in den Herkunftsländern zusammenarbeiten, wie gewährleisten wir, dass die Leute, wenn sie hierher kommen, tatsächlich alle Papiere haben. Das Gesetz unterstellt das einfach, in der Praxis ist es dann aber am Ende doch schwierig.
Angesichts solcher Effizienzgewinne sollten wir über dieses Thema noch einmal ohne Scheuklappen ins Gespräch kommen, um am Ende das zu tun, was das Vernünftigste, das Effizienteste und auch das Sparsamste ist und trotzdem den Menschen das Gefühl gibt, wir sind alle wieder handlungsfähig.
Das ist ja das, was mich am Thema unseres lähmenden Prozesses mit der Kreisumlage innerlich am meisten beschäftigt. Wenn ich die Wahlergebnisse sehe, die kommen auch daher, dass die Menschen Überdruss empfinden. Wir sollten alle, ich habe es vorhin schon gesagt, alle liefern, liefern, liefern.
Kein Mensch interessiert sich dafür, um Bismarck zu persiflieren, wie Wurst gemacht wird und wie Politik gemacht wird und wie Verwaltung gemacht wird. Wir werden alle nur an dem gemessen, was hinten rauskommt, was am Ende auf dem Tisch liegt, und da gilt es sehr schnell besser zu werden. Wir werden diesen blauen Spuk sonst nicht beenden können.
Henneke: Das ist gleich die Überleitung zum nächsten Thema. Ich glaube, es ist wertvoll, dass wir jetzt hier gesehen haben, wie alle Beteiligten im Grunde die gleichen Ziele verfolgen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ganz einfach. Wir brauchen einerseits politische Gestaltungsspielräume und keine Überregulierung und müssen auf der anderen Seite eine Überforderung des kommunalen Bereichs verhindern.
Nur zur Erinnerung: Wir haben in den ersten drei Quartalen 2024 im kommunalen Bereich ein Defizit von 25 Milliarden Euro angehäuft. Runtergerechnet auf die 400 kreisfreien Städte und Landkreise bedeutet dies ein Minus von je 63 Millionen Euro. Damit kann man niemanden für die Kommunalpolitik gewinnen.
Lieberknecht: Richtig. Eigenverantwortung, um die es uns hier geht, setzt ja auch Freiheit voraus, und zwar auch finanzielle Freiheit. Ohne diese Freiheit kann ich keine Verantwortung wahrnehmen. Und Eigenverantwortung bedeutet aus meiner Sicht auch Resilienz und Würde.
Das Ganze kommt aus dem Subsidiaritätsprinzip, wie es Papst Pius XI am Vorabend der Diktaturen des 20. Jahrhunderts formuliert hat, dass möglichst das, was auf der unteren Ebene erledigt werden kann, dieser Ebene belassen werden soll. Da gehört Familie dazu, da gehört auch Ehrenamt dazu.
Das ist die kommunale Ebene. Und das hat einen guten Grund, weil man – auch im Interesse der Demokratie und um Diktaturen zu wehren – die untere Ebene stark machen muss. Man muss sie resilient ausstatten, in die Lage versetzen, zu helfen, statt ständig nur Frust zu erzeugen.
Gerade weil beide Ebenen – Land wie Kommunen – nicht genügend Geld haben, muss nach meiner Überzeugung aus dem Ruf nach mehr Geld der Ruf nach mehr Geist werden. Damit meine ich jetzt ganz bestimmt nicht den Landrat und ich meine auch nicht die Kommunen, sondern ich meine diejenigen, die über die – wir können das ja verfolgen – letzten 10, 15, 20 Jahre Standard um Standard erhöht haben, natürlich immer im Interesse der guten Sache, immer im Interesse von mehr Menschenwürde und was auch sonst immer. Aber das ist am Ende überbordend. Es erzeugt Frust, weil es uns schlichtweg nicht nur im Sozialen, sondern auch im Verwaltungsverzug überfordert. Denken sie allein daran, wofür es mittlerweile alles Beauftragte gibt. Das hat man früher alles irgendwo auch erledigt, ohne dass es unmenschlich war. Und das werden wir uns nicht mehr leisten können.
Jetzt reden wir über die Milliarden, die wir brauchen für die Herausforderungen, die alle über uns hereingebrochen sind, auf die man auch nicht vorbereitet war. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir aktuell die größten Steuereinnahmen sehen, die wir je hatten, die aber komplett verplant sind für die Dinge, die am Ende nur nice to have sind.
Wir werden in Zukunft nicht mehr in der Lage sein, eine komplette Betreuungsstruktur kostenfrei zur Verfügung stellen. Man kann eben nicht auf jeden Schutz irgendwo staatlich zementiert versuchen aufzusetzen. Das haut nicht mehr hin. Und da müssen wir uns ehrlich machen.
Im Übrigen, Herr Robra, kann man allerdings nicht ganz so salopp mit den freien Trägern umgehen. Da gibt es auch ein paar Schwierigkeiten. Also man muss da zu einem vernünftigen Verhältnis kommen. Aber man darf sich nicht ausnutzen lassen. Es darf nicht überborden. Aber im Interesse einer wirklichen Subsidiarität habe ich immer für die kleinen Einheiten gestanden.
Und ich finde, es lohnt sich auch. Von daher, ich kann jetzt zu dem Verfahren konkret nichts sagen, aber es ist wichtig, dass da Klarheit hergestellt wird. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das Gericht das in seiner Weisheit dann entscheiden wird und ob es wirklich hilfreich sein wird. Aber auch, wenn es dann das Urteil gibt, wird es sich nicht vermeiden lassen, dass Standards auch mal wieder zurückgenommen werden müssen.
Henneke: Wie sehen Sie das, Herr Burgi?
Burgi: Der jetzige Zustand ist natürlich auch juristisch betrachtet außerordentlich unerquicklich. Fast könnte man sich überlegen, ob statt der Oberverwaltungsgerichte nicht die Familiengerichte für zuständig erklärt werden sollten, weil sich die kommunale Familie gegenseitig mit Streitigkeiten überzieht. Das kann es nicht sein.
Von dem Verfahren in Karlsruhe erwarte/erhoffe ich mir drei Dinge:
Erstens, dass das Gericht sich richtig intensiv und umfassend der kommunalen Selbstverwaltung widmet. Ungefähr auf dem Level, in dem es sich dem Klimaschutz gewidmet hat. In diesem Verfahren ist ein gordischer Knoten durchgeschlagen, eine neue Grundrechtsdimension erfunden, ein Klimaschutzgebot entwickelt worden.
Das alles brauchen wir hier nicht, weil es mit Art. 28 Abs. 2 bereits eine konkrete Verfassungsnorm gibt. Aber dieser kann man natürlich deutlich mehr Rückenwind geben, mehr Kraft, als es bisher gemacht worden ist.
Konkret bedeutet das – zweitens –, dass man jetzt die Eigenverantwortlichkeitsgarantie vermessen muss. Die bisherigen Urteile haben sich, wenn man als letztes ganz großes Urteil vielleicht die Rastede-Entscheidung nimmt, mit der Aufgabenebene befasst. Und dabei ging es damals um eine ganz andere Perspektive wie heute, weil das Land den Kommunen Aufgaben entzogen hat und das Gericht versucht hat, dagegen einen Schutzwall zu errichten.
Das heutige Thema ist genau entgegengesetzt. Es werden ständig Aufgaben überbürdet, aber nicht immer mit der angemessenen finanziellen Ausstattung versehen, was in der Konsequenz zu Problemen mit der Eigenverantwortlichkeit führt. Und dieser zweite Schutzgehalt ist nicht so richtig bisher vermessen worden wie der erste. Und das erhoffe ich mir von diesem Urteil.
Und drittens erhoffe ich mir auch, dass der Stellung der Kreise – und ich sage das nicht, weil wir jetzt bei einer kreislich inspirierten Veranstaltung sind –, stärker Rechnung getragen wird. In der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts werden die Kreise ein wenig wie Kommunen zweiter Klasse behandelt. Das liegt natürlich auch daran, dass im Grundgesetz steht, dass sie kein Aufgabenerfindungsrecht haben, dass ihre Aufgaben durch die Gesetze bestimmt werden.
Das heißt, das Grundgesetz hat das ein Stück angelegt, aber eben nur betreffend diese Aufgabenebene, nicht betreffend die Eigenverantwortlichkeit. Dieser zweite Schutzgehalt, um den es jetzt geht, nämlich die Eigenverantwortlichkeit, ist jedenfalls nach meiner Lesart des Art. 28 Abs. 2 GG nicht abgestuft, sondern der steht beiden – Gemeinden wie Landkreisen – gleichermaßen zu. Und da es um diesen Schutzgehalt jetzt geht, besteht, so glaube ich, die große Chance, dass das Gericht die insoweit bestehende Gleichwertigkeit bekräftigt.
Und letzter Punkt, der eng damit zusammenhängt: Vielleicht trägt das Gericht auch dem Umstand Rechnung, dass sich durch die Funktionalreformen der letzten Jahrzehnte in allen Bundesländern insbesondere die kreisliche Ebene fundamental verändert hat und letztlich zur untersten Ebene des Staates geworden ist. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen: Wenn ich in Bayern in der Vorlesung ein Beispiel geben soll für eine untere Landesbehörde, muss ich zehn Minuten lang überlegen. Mir fällt dann ein das Landesamt, das mein eigenes Gehalt überweist, aber dann hört es auch schon auf eigentlich.
Das heißt, sämtliche anderen Aufgaben sind kommunalisiert worden. Und das hat man ja in fast allen Bundesländern, in Schattierungen, so ähnlich gemacht. Das heißt, ich habe heute eine ganz andere Relevanz dieser Ebene und dem muss verfassungsgerichtlich Rechnung getragen werden.
Aber wie gesagt, das sind Hoffnungen, Erwartungen. Es hat immerhin den Anschein, dass es sich um eine Senatsentscheidung handeln wird. Was dabei rauskommt, werden wir sehen, vielleicht bei der nächsten Jubiläumsveranstaltung.
Demokratie und Extremismus
Henneke: Damit sind wir beim letzten Thema des Abends angekommen, dem Umgang mit extremistischen Parteien auf kommunaler Ebene. Auch dazu einen Satz als Einführung: Nach den taggleichen Kommunal- und Europawahlen im letzten Sommer mussten wir konstatieren, dass die Karte, die ausweist, welche Partei in den Kreistagen in Ostdeutschland die stärkste Fraktion stellt, fast durchgehend blau war. Wenn man dann aber schaut, wie es mit den Landräten bzw. den Vorsitzenden der Kreistage aussieht, ergibt sich ein anderes Bild. Hinsichtlich der Landräte gibt es nach wie vor nur einen „blauen“ Landkreis, bei den Vorsitzenden der Kreistage keinen einzigen.
Vor diesem Hintergrund zunächst an Sie, Herr Bauer, die Frage, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen.
Bauer: Wie gehe ich damit um? Hemdsärmlich. Ich muss mich der Sache stellen, ich muss arbeiten. Ich habe eine Aufgabe als Hauptverwaltungsbeamter im Kreistag. Die Fragen, egal aus welcher Ecke sie kommen, die bekomme ich ja nicht von einer Partei, die bekomme ich von gewählten Vertretern einer Fraktion, die muss ich auch beantworten. Dem kann ich mich nicht verweigern. Dies zur Arbeit im Kreistag.
In der Bevölkerung, wenn man ein bisschen diskutiert und wenn man reinbohrt, merkt man schon, wer was wählt und manche gehen auch sehr offen damit um. Viele von denen würde ich dabei nicht als rechts einstufen. Die sagen mir dann aber: Meine Wahl ist nicht, dass ich für das und das bin, sondern ich stelle fest, so wie es gerade ist, möchte ich es nicht. Das ist die Aussage, die ich bekomme.
Was folgt daraus: Ich glaube, in der Zukunft müssen Antworten für die Fragen geliefert werden, die die Bevölkerung im Schwerpunkt gerade interessieren. Welche das sind, dass wissen wir ja ziemlich genau.
Auf diese Fragen muss die neue Regierung, hoffentlich als große Koalition mit SPD und CDU, nun tatsächlich Antworten finden und nicht nach vier Jahren schon wieder sagen, die Dinge müssten nur besser erklärt werden. Ich glaube, es liegt manchmal nicht nur am Erklären, es liegt manchmal auch wirklich am Thema.
Robra: Für mich ist es unübersehbar, dass Staat und Gesellschaft in der Art und Weise, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben, Überdruss bei den Menschen erzeugen. Das liegt aus meiner persönlichen Sicht daran, dass wir eine komplexe Struktur geschaffen haben, die jedweder Transparenz entbehrt, keiner durchschaut das mehr, um es mal einfacher zu sagen. Diese Komplexität muss deutlich reduziert werden. Wir müssen daran arbeiten, dass das, was wir machen, wieder verständlich wird. Ferner müssen wir deutlich entschlussfähiger werden, schneller werden und Verfahren miteinander finden, bei denen wir die Menschen mitnehmen.
Wir haben hier Wahlergebnisse auf Landesebene, die kann man niemandem erklären. Sepp Müller z.B., ein CDU-Abgeordneter aus Wittenberg, sehr jung, schon sehr erfolgreich, Fraktionsvize in Berlin, der wirklich etwas bewegt hat für seinen Wahlkreis, für das Land Sachsen-Anhalt, für Ostdeutschland insgesamt, der wird in seinem Wahlkreis, den er bisher immer fast mit CSU-Ergebnissen gewonnen hatte, von jemandem geschlagen, dessen Familie wir hier im Lande Sachsen-Anhalt zwar kennen, weil sein Bruder mal in der CDU-Fraktion im Landtag gewesen ist, der aber weder im Kreistag noch im Stadtparlament noch sonst wo irgendwas getan hat, aber schneidig in Zimmermannsuniform auftritt, denn er ist Dachdecker von Beruf. Das kam an. Es ist aber oft gar keine politische Botschaft dahinter.
Natürlich gibt es die großen Themenfelder, Migration, Wirtschaft. Und natürlich hat es auch sozioökonomisch objektiv nachvollziehbare Gründe, wenn eine Partei wie die Linke jetzt bei den Jungen, die AfD dagegen bei den Älteren Erfolge feiert. Aber auch diese Parteien haben auf die genannten Fragen nicht wirklich eine Antwort, außer diesen ganz einfachen, wie: Grenze dicht.
Aber so einfach ist es ja nicht, es ist im praktischen Vollzug schwieriger. Insoweit zu überzeugenden Lösungen zu kommen, das muss für mich eines der Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen in Berlin sein.
Wenn ich allein bedenke, die meisten hier haben es ja mitgekriegt und aufmerksam verfolgt, was wir in der Ministerpräsidentenkonferenz auch mit dem Kanzler alles beschlossen haben zu den unterschiedlichsten Fragen, ob das Wirtschaft, Migration oder was auch immer gewesen ist, da waren sich alle 16 Landesfürsten und der Kanzler einig – und dann ist es im Koalitionsgeflecht in Berlin wieder an irgendeiner Stelle hängengeblieben. Diese Prozesse müssen sich fundamental ändern, zumal angesichts der außenpolitischen Randbedingungen, die die Leute natürlich auch extrem verunsichern.
Niemand will in einer Atmosphäre leben, die von Unsicherheit geprägt ist. Jeder will seinen Feierabend genießen, wenn er nach Hause kommt und vielleicht noch ein bisschen über Politik philosophieren, aber wenn man das Gefühl hat, es passt alles nicht, wir müssen uns größte Sorgen machen, auch um unsere Kinder und Enkel, dann erhalten wir Wahlergebnisse mit 60 Prozent der Stimmen am linken und rechten Rand.
Wir können das nicht mehr mit bloßen Floskeln hinwegreden, sondern wir müssen handeln und liefern.
Henneke: Wie ist Ihre Einschätzung, Frau Lieberknecht?
Lieberknecht: Ich bin sehr nachdenklich geworden. Weniger wegen des Landrats in Sonneberg. Da kann man genügend Gründe nennen, die am Ende auch bei den eigenen Leuten landen. Eine gespaltene CDU vor Ort war letztlich einer der Auslöser. Also das kann man rational noch einigermaßen erklären.
Die Kommunal- und die Europawahl haben wir in Thüringen ziemlich weggedrückt, weil unterm Strich die CDU als Siegerin hervorgegangen ist: Wir haben mehr Landräte als wir vorher hatten, und es kam kein weiterer AfD-Landrat dazu.
Bei der Landtagswahl ist Mario Vogt dann Zweiter geworden und konnte die Regierung bilden. Das hat auch viele irritiert. Aber auch da gibt es eine eigene Geschichte. Hat alles auch mit Personen zu tun und die sind halt alle pragmatisch, die da jetzt miteinander koalieren und ich hoffe, das hält eine Weile.
Aber jetzt die Bundestagswahl. In unseren Dörfern hat die AfD Stimmenanteile von 40, 50, 60 Prozent und mehr erzielt. In meinem eigenen Dorf waren es 48 Prozent. Bei sechs, sieben, vielleicht zehn der rund 100 Häuser, die es dort gibt, wusste ich, dass die Bewohner für die AfD stimmen werden. Aber dass nun in fast der Hälfte der Häuser entsprechend abgestimmt wurde, macht mich sehr nachdenklich. Darunter sind auch gut situierte Leute, das sind Krankenpfleger, das sind Lehrerinnen, das ist ein Arzt, das sind Professoren, das sind Informatiker, Handwerker. Natürlich gibt es auch Rentner, aber auch die laufen nicht den ganzen Tag so frustriert herum, dass man ihnen schon auf der Stirn ansehen könnte, wen sie wählen. Also wir kommen mit unseren bisherigen Erklärungen – dem viel zitierten West-Ost-Gegensatz, die Rede von den Wessis, die den Osten über den Tisch gezogen haben, oder die fehlenden Artikulationsmöglichkeiten der Ostdeutschen – nicht mehr weiter.
Es geht um Leute, die im Leben stehen, die auch ihre Familien, die ihre Kinder haben. Und wenn es um die Hälfte des Dorfes geht, dann muss es ja auch um Leute aus meiner Straße gehen, auch wenn ich im Einzelnen nicht weiß, um wen. Keiner von denen ist mir mit irgendwelchen Nazisprüchen begegnet, die sind im Heimatverein, die sind in der Feuerwehr, die gehen auch in die Kirche, zum Teil, nicht alle, ein paar immerhin aber noch.
Was ich aber mitbekommen habe durch meine Kontakte im Dorf: Die Regierungsarbeit der Ampel war für viele indiskutabel, und zwar insbesondere wegen der fehlenden Kompetenz in einigen der zentralen Ressorts. Gerade in Ostdeutschland gibt es ein Gespür für ein ersichtlich ideologiegetriebene Politik, das lehnt der Ostdeutsche nach seinen Erfahrungen ab – auch in den nachwachsenden Generationen. Wenn der politische Diskurs, wenn Presseerklärungen und Medieninformationen nicht mehr übereinstimmen mit dem, was die Leute täglich erleben – dafür gibt es eine hohe Sensibilität.
Auch Krieg und Frieden ist ein großes Thema. Viele haben gesagt: Also Friedrich Merz und Taurus, das geht gar nicht. Dahinter steckt wohl auch die ostdeutsche Erfahrung, dass man sich mit den Russen irgendwie arrangieren muss, wenn man überleben will. Nur wenige im Osten waren dazu nicht bereit und haben es riskiert, dafür ins Gefängnis zu gehen.
Die westdeutsche Erfahrung ist dagegen eher von einem Gefühl der Überlegenheit geprägt, weil man den Kalten Krieg gewonnen hat.
Das sind, glaube ich, zwei Mentalitäten, über die wir auch nochmal reden müssen und diese Frage nach Krieg und Frieden, die hat am Ende, so glaube ich, der CDU im Osten auch das Genick gebrochen.
Henneke: Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir mitnehmen für eine neue Veranstaltung. Zum Abschluss noch die Einschätzung von Martin Burgi.
Burgi: Ich glaube, wir müssen hier sehr gut aufpassen bei dem Reden über Verwaltung, dass wir nicht den Scharfmachern oder den Ideologen der Rechten in die Falle gehen. Es ist richtig, dass die Bürgerinnen und Bürger etwas erwarten und dass vieles vielleicht nicht mehr so funktioniert wie früher.
Nach wie vor ist aber unsere Infrastruktur nicht komplett marode, nach wie vor ist auch unsere Verwaltung weder korrupt noch arbeitsscheu. Das heißt, wir dürfen nicht von morgens bis abends diese Platte mitsingen. Denn die Bürgerinnen und Bürger, die Wähler, haben das berechtigte Anliegen, das muss irgendwie funktionieren.
Auch ich würde sagen, dass nicht alle Wähler der AfD Rechte sind. Aber die Ideologie der AfD ist eindeutig dadurch gekennzeichnet, dass sie den Staat und die Verwaltung diskreditieren will. Die nennen das Deep State. Der Deep State ist ein rechtes Narrativ, das weltweit von den Rechten gepflegt wird und darauf hinauf zielt, die gegenwärtig in Staat und Verwaltung Verantwortung Tragenden, das heißt ziemlich alle, die in diesem Raum sitzen, zu diskreditieren und herabzusetzen, um sie im Falle der eigenen Machtübernahme durch eigene Gewährsleute zu ersetzen.
Und genau das erleben wir momentan in den USA. Elon Musk wurde nicht von Alice Weidel eingeladen, weil beide für die Zukunft des E-Autos stehen. Im Gegenteil, die AfD will das E-Auto ja verbieten, sondern wegen dieses Themas. Und deswegen müssen alle, die für Verwaltung, für Rechtsstaatlichkeit, für Anstand, für Maß und Mitte stehen, an dieser Stelle ganz klar eine Grenze ziehen.
Wir haben in den ersten Jahren immer sehr stark das ausländerfeindliche Element bei der AfD betont, das ist auch nach wie vor richtig, glaube ich, aber wir müssen mit der genau gleichen Konsequenz und Deutlichkeit auch auf dieses riesige Narrativ, was wie gesagt international unterfüttert wird, hinweisen.
Es gibt Studien und empirische Anhaltspunkte dafür, was diese Leute vorhaben und man sieht, sobald sie nur einen Fitzel der Macht in der Hand haben, werden sie es durchziehen und zwar mit einer Brutalität, die wir uns alle gar nicht vorstellen können und da ist es mir lieber, ich warte mal 10 Minuten länger auf einen Zug der Deutschen Bahn AG.
Henneke: Vielen Dank, Herr Burgi, das war ein gutes Schlusswort.
 Zahlreiche Gäste aus dem kommunalen Bereich aus ganz Deutschland waren anwesend
Zahlreiche Gäste aus dem kommunalen Bereich aus ganz Deutschland waren anwesend
Die politische Landschaft in Deutschland und Europa ist von vielen Krisen und Herausforderungen geprägt, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt beeinträchtigen. Die Wahlerfolge extremistischer Parteien zeigen deutlich, dass Unzufriedenheit in weiten Teilen der Bevölkerung besteht. Der am 23.2.2025 neu gewählte Bundestag steht vor der Aufgabe, Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu stärken und die Grundlagen für eine stabile Gesellschaft zu sichern.
Gerade in diesen unruhigen Zeiten wird deutlich, wie wichtig die Rolle der Kommunen als Keimzellen der Demokratie ist. Städte, Gemeinden und Landkreise sind die unmittelbare Verbindung zwischen dem Staat und den Bürgern. Hier werden politische Entscheidungen für die Menschen greifbar und erlebbar.
Damit Kommunen dieser Rolle gerecht werden können, benötigen sie in überschaubaren Strukturen echte Entscheidungsspielräume und die notwendige finanzielle Ausstattung. Ohne kommunale Eigenverantwortlichkeit wird das demokratische Fundament brüchig, da Bürgernähe und Mitgestaltungsmöglichkeiten verloren gehen.
Die Veranstaltung fand anlässlich des Ausscheidens von Heinz-Lothar Theel aus dem Amt des Geschäftsführenden Präsidialmitglieds des Landkreistages Sachsen-Anhalt statt. In Würdigung seines jahrzehntelangen Engagements für die kommunale Selbstverwaltung wurde über die Herausforderungen und Potenziale kommunaler Eigenverantwortlichkeit diskutiert.
Programm
17:00 Uhr | Empfang
17:30 Uhr | Begrüßung
Rainer Robra | Staatsminister und Chef der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke | Präsident der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V.
Diskussion
Christine Lieberknecht | Ministerpräsidentin a.D. Thüringen
Rainer Robra | Staatsminister und Chef der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt
Markus Bauer | Landrat Salzlandkreis
Prof. Dr. Martin Burgi | Lehrstuhl Juristische Fakultät, LMU München
Leitung der Diskussion
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke | Präsident der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V.
Hauptgeschäftsführer Deutscher Landkreistag
anschließend Ausklang mit Imbiss

Die Veranstaltung wurde durch eine Spendenaktion zugunsten der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft anlässlich der Verabschiedung des Geschäftsführenden Präsidialmitglieds des Landkreistages Sachsen-Anhalt, Heinz-Lothar Theel, ermöglicht und in Kooperation mit dem Landkreistag Sachsen-Anhalt durchgeführt.
AKTUELL
Podiumsdiskussion in Berlin
zur Kommunalen Selbstverwaltung

Zusammenfassung jetzt verfügbar!
» mehr
im Rahmen des 9. Nassauer Dialogs
am 24. Oktober 2025 in Nassau/Lahn

Zusammenfassung jetzt verfügbar!
» mehr
Format für Nachwuchs-Führungskräfte
24.-26. Oktober 2025
Dokumentation folgt!
» mehr
Cookies:
Diese Webseite nutzt Cookies um unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.